
Schleswig-Holstein soll wilder werden. Anfang 2016 will der Landtag über eine Neufassung des Landesnaturschutzgesetzes abstimmen. Beim 21. Naturschutztag in Rendsburg erklärte Umweltminister Robert Habeck: „Wenn wir Akzeptanz für mehr Wildnis in Schleswig-Holstein erreichen wollen, müssen wir die Menschen einbinden. Sie müssen Wildnis als etwas Faszinierendes hautnah erleben können”. Das klang nach mehr Freiheit.
Wildnis ist für mich, wenn ich nach einem Tagesmarsch auf einer Anhöhe stehe, um kilometerweit zu gucken, mich dann 360 Grad um die eigene Achse drehe, ohne ein Zeichen für Zivilisation zu sehen, also keine Bauten, weder ein Gipfelkreuz noch einem Strommast, ja, nicht mal den Kondensstreifen eines Flugzeuges am Himmel. Verletzungen oder eine plötzlich auftretende Krankheit wachsen dort rasch zur humanitären Katastrophe aus. Das ist faszinierend anders als daheim.
Faktisch existiert bei uns in Schleswig-Holstein diese Art von Wildnis nicht mehr. Für die Allgemeinheit beschränkt sich wildes Naturerleben auf versprengte Gebiete unterschiedlichen Schutzfaktors, die großzügig hochgerechnet kaum mehr als acht Prozent der Landesfläche ausmachen. Einiges davon ist für mich gesperrt. Der Entwurf zu einer Novelles des Landesnaturschutzgesetzes sieht nun vor, zwei Prozent der Landesfläche in Wildnisgebiete zu entwickeln. Damit vergrößert sich mein Erholungsgebiet jedoch nicht, denn Habeck stellt sich darunter eine „Vertiefung bestehender Gebiete“ vor, was den Ausschluss der Öffentlichkeit zur Folge haben wird, um „die Natur weitgehend unbeeinflusst von menschlichen Nutzungen” (§12 Biotopverbund) zu erhalten.
Am Wegrand Pause zu machen, ist im Naturschutzgebiet erlaubt, sofern ich bloß raste und das dem einfachen Lagern entspricht. Es darf aber nicht nach Kampieren aussehen, denn das gilt deutschlandweit als Straftat. Will ich außerhalb dieser Zonen in Wald und Flur wild campen, sagt mir das aktuelle LNatSchG, muss ich dazu „privatrechtlich befugt sein“ und es dürfen „keine anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen“ (§ 37; 2). Im Klartext heißt das, ich brauche Erlaubnis. Habe ich die nicht, riskiere ich Bußgeld. Auch daran wird die Gesetzesnovelle nichts ändern.
In diesem Punkt müht sich die Kampagne „Wildes Schleswig-Holstein“ von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein mit ihrem Schirmherrn Robert Habeck um Ausgleich. Auf deren Internetportal finden wir die Koordinaten von 15 Übernachtungsplätzen. Sie dürfen von Wanderern oder Radfahrern mit maximal zwei Zelten zu jeweils drei Personen belegt werden. Dafür brauchte es keine Gesetzesänderung. Es handelt sich um offiziell genehmigte Plätze an Wegrändern oder auf Privatgrund, ganz im Sinne des LNatSchG. Einen davon nutzte der Umweltminister bei seiner sommerlichen Promotiontour, um „symbolisch den Gedanken des skandinavischen Jedermannsrechts mit nach Schleswig-Holstein“ zu bringen.
Querfeldein stiefeln wie beispielsweise in Norwegen ist bei uns nicht erlaubt. In freier Landschaft darf sich zum Erholungszweck nur aufhalten, wer auf Wegen bleibt. Dieses restriktive Betretensrecht wird mit der Novelle an großzügigere Regelungen anderer Bundesländer angepasst. Sobald Schleswig-Holsteins Äcker abgeerntet sind und auf Grünland nichts mehr wächst, soll ich sie nach Lust und Laune betreten dürfen (§ 30). Dieser angedeutete Wink in Richtung Allemannsrett ist in der Tat kaum mehr als ein symbolischer Akt. Und so bleibt es dabei: Der echt wilde Norden fängt für mich Höhe Padborg an.
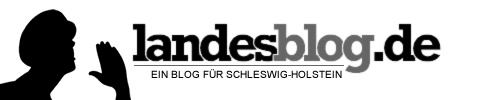
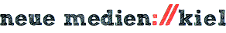

Für uns Menschen mag die Erholung im Mittelpunkt stehen, darum geht es bei der Einrichtung der Wildnisgebiete nicht. Deswegen sind sie auch Teilmenge des Biotop-Verbundes: sie sollen Pflanzen und Tieren einen Rückzugsorten ohne Einfluss des Menschen bieten, in denen sich die evolutionären und biologischen Prozesse frei entfalten können. Dies soll eine gewisse Natürlichkeit unserer Ökosysteme bewahren und auch als Referenz zur Kulturlandschaft dienen — gerade im Zuge des Klimawandels werden solche Referenzflächen sehr wichtig.
Aber natürlich findet man in Schleswig-Holstein keine völlig unbeeinflussten Flächen mehr. Sowas existiert in Mitteleuropa schlicht nicht mehr. Dies sollte uns aber motivieren die wenigen, noch annähernd „wilden” Flächen ganz besonders zu schützen. Es ist alles was uns von der ursprünglichen Natur zwischen den Meeren geblieben ist.
Freie Entfaltung für evolutionäre und biologische Prozesse wäre prima. Da bin ich dabei. Doch mit der „Vertiefung bestehender Biotope” werden meiner Befürchtung nach ausgewählte Tiere und Pflanzen subventioniert, genauso wie anderswo die Landwirte, Autofahrer, Investoren. Wieder erlernt werden soll aber doch, Balance zu halten, Achtsamkeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Ökosystemen zu entwickeln. Dafür hätte ich gern ein kleines, wildes Testgelände, vielleicht mit der Möglichkeit, am Ziel meines Tagesmarsches zur Belohnung an einem Platz meiner Wahl campen zu dürfen oder in einer Hytte — wenn es denn sein muss, gegen Gebühr und nach vorheriger Anmeldung. Aber nicht am Wegrand, neben Parkplätzen oder auf privatem Hofgelände wie es das „wilde Schleswig-Holstein” vorschlägt sondern mittendrin in der Wildnis.
Bei der „Vertiefung” geht es meiner Beobachtung weniger darum bestimmte Arten zu bevorzugen — in „Wildnis”-Gebieten soll die Pflege tatsächlich eingestellt werden — als mehr um die politische Botschaft, dass dafür keine zusätzlichen Schutzgebiete geschaffen werden. So soll dem potentiellen Widerstand von Bauernverband & Co. direkt der Wind aus den Segeln genommen werden.
Bezüglich der wilden Campen in echter Wildnis gebe ich aber Recht. Das ” wilde SH” ist nur ein Marketinggag.
Habeck hat sich mit seiner Absage an Zielbestimmung 12 % Waldfläche in Schleswig-Holstein in meinen Augen sehr unglaubwürdig gemacht (http://www.shz.de/schleswig-holstein/politik/habeck-keine-hoffnung-auf-mehr-wald-in-sh-id3942471.html). „Vertiefung” ist gut, mehr Waldfläche braucht es aber auch.
Herr Habeck sollte mehr über die zum Teil völlig falsch erteilten Subventionen aus Brüssel für nicht tiergerechte Grossbetriebe mit Massentierhalltung die mit ihren Abfällen die Böden und die Natur belasten nachdenken und für Abhilfe sorgen.