Eine Woche, bevor das Buch Der Kulturinfarkt in die Läden kam, kochte die Diskussion um die dort vertretenen Thesen schon hoch. Angeregt waren die Auseinandersetzungen durch einen von den Autoren geschickt platzierten Artikel im SPIEGEL vom 12. März. Armin Klein, Pius Knüsel, Stephan Opitz und Dieter Haselbach kennen sich mit Kulturmarketing aus. Dass ihnen ein Coup mit einem Knall gelungen ist, kann ihnen nicht vorgeworfen werden – das ist legitim. Sogar einen Trailer zum Buch hat der Verlag produziert. Im SPIEGEL-Artikel vertreten sie unter der plakativen Überschrift Die Hälfte einen radikalen Umbau der bisherigen Kulturförderpolitik. Die zum Teil heftigen Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.
Schon am Tage der Veröffentlichung meldeten sich die Kulturwelt und die Politik zu Wort. Dort hieß es, die Thesen seien „konzeptlos“ (Siegmund Ehrmann, MdB SPD) oder ein „Armutszeugnis“ (Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates), den Autoren warf man „Unwissen und einen Mangel an kulturpolitischer Verantwortung” vor (Deutscher Bühnenverein). Der Tagesspiegel begann zwar unter seinem Niveau, als er die Autoren als „kaum bekannt“ bezeichnet. Die darauf folgende kritische Auseinandersetzung von Peter Laudenbach mit den Thesen ist aber etwas differenzierter und mancher Kritik müssen sich die Verfasser stellen. Die taz rezensierte zwar das Buch nicht, widmete aber Stephan Opitz aus Kiel ein faires Porträt, in dem dieser Möglichkeit nutzen konnte, in der Diskussion mehr Sachlichkeit einzufordern. Der Artikel in den Kieler Nachrichten ist eher als Aufweis der Arroganz des Feuilletons zu lesen denn als eine konstruktive Auseinandersetzung. Schade. Gerade in unserem Land hätte es der substanziellen Rezeption bedurft. Der Blog nachtkritik.de fasste die Reaktionen des Feuilleton prägnant zusammen.
Der schleswig-holsteinische Landeskulturverband (LKV) weist die Thesen ebenfalls kategorisch zurück: „Sie [die Autoren, Anm. M.L.] retten nichts und niemanden. Sie erhalten nichts und niemanden“, zitiert die Landeszeitung den Vorsitzenden Rolf Teucher. Er deutet auf die eh geringe Kulturfördersumme im Land. Dass Manna, von dem die Autoren in ihrem Buch sprechen (73), fällt halt nicht überall gleichzeitig. Auf der Homepage des LKV findet sich keine Stellungnahme. Der Intendant der Kieler Bühnen, Daniel Karasek, nennt im NDR-Interview Buch und Artikel ein „freches Pamphlet“.
Ein Wuppertaler Blogger dagegen ist ganz begeistert, er wünscht sich eine kritische Auseinandersetzung mit der Klasse der Kulturschaffenden und die notwendige Selbstkritik. Einhellige Unterstützung auch durch das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.
Manche Reaktion disqualifizierte sich durch ihren Stil leider selber. Der Deutsche Kulturrat, eine eigentlich sehr honorige Einrichtung, brachte in seiner Stellungnahme die Diskussion leider auch auf die persönliche Ebene, fragte die Institutionen an, in den die Autoren arbeiten, die ja schließlich auch öffentlich gefördert werden. Der Blogger Moritz Egger agiert ähnlich, macht den Expertencheck, aber sein Blog heißt ja auch Bad Blog. Das mag ja alles als Faktum stimmen, aber in der Diskussion um Sachfragen dürfen solch personifizierten Argumente eigentlich keine Rolle spielen. Wer die persönliche Ebene sucht, entzieht sich der sachlichen Auseinandersetzung. Dieter Haselbach hat immerhin wegen der persönlichen Diffamierung seine Funktion als Geschäftsführer des Zentrums für Kulturforschung niedergelegt, um, wie er sagt, die Institution zu schützen. So weit darf Kritik nicht verfangen, die Kultur unseres Staates zeichnet sich auch dadurch aus, dass Meinungsfreiheit herrscht.
Was wollen die vier Kulturmusketiere?
Sie wollen, so sagen sie, durch eine Polemik aufrütteln, verkrustete Strukturen in Bewegung bringen und mehr Wettbewerb erreichen. Räume für Kunst ermöglichen, sagt Armin Klein im Buchtrailer. Und ja, natürlich brauchen wir, nach Meinung von Klein, Knüsel, Haselbach und Opitz, mehr Nachfrageorientierung. Die Autoren stellen im Spiegelartikel fest: „Die kulturelle Flutung Deutschlands wurde stets vom Angebot, nicht von der Nachfrage her gedacht. Der Vormarsch der geförderten Kultur produziert nicht Vielfalt, sondern Konformität – Übereinstimmung mit Fördermatrizen, Projektformaten und vertraglich abgesicherten Leistungen.“ Der Aspekt ist nichts Neues, kann man den Aufregern entgegenhalten; die Bedeutung der Nachfrage und Kundenorientierung findet sich schon im Standardwerk von Armin Klein zum Kulturmarketing.
Geht es nur um Kürzungen, um die Hälfte, wie die Überschrift im Spiegel lautete? Nein, das ist nur die Schlagzeile gewesen, auf die sich viele Äußerungen beziehen. Liest man das Buch genau, kommt man zu einer differenzierteren Sicht. „Wonach wir suchen“, schreiben die Verfasser auf Seite 175, „sind jene Mechanismen, die uns vor dem Kulturinfarkt bewahren. Die uns davon befreien, dass so vieles sich politisch verankert hat und nicht sterben darf, obwohl weder Ressourcen vorhanden sind noch eine Notwendigkeit ausgewiesen ist, dass es bleibt.“ Das ist, was es in der Kultur wirklich braucht. Eine zukünftige Kulturpolitik muss sich, nach Aussage des Buches, an den Paradigmen Mündigkeit, Rationalität, Gleichberechtigung und Widerspruch zu orientieren. Verknappung schaffe einen Mehrwert für die Kultur und womöglich sei es gar nicht so, dass jeder Mensch ein Künstler werden könne oder an der Kultur teilhaben wolle. Ziel der Autoren ist es, die vorherrschende Kulturförderung so umzubauen, dass Innovationen und neue Ideen möglich sind. Dabei haben sie unter anderem die nach ihrer Sicht aufgeblähten Verwaltungen (im Exkurs benennen sie explizit die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) im Blick, die Entwicklungen eher behindern würden.
Fünf Schwerpunkte
Die Autoren selber schlagen fünf Schwerpunkte vor, die der besonderen Förderung verdienen: Angemessenere Förderung von Einrichtungen, verbunden mit Vorgaben des sozialen Engagements, Unterstützung der Laienkultur, Förderung der Kulturindustrie und Kulturwirtschaft sowie von Hochschulen der kulturellen Bildung mit dem Auftrag, praxisbezogen zu arbeiten. Nicht zuletzt schlagen sie vor, die kulturelle Bildung zu verstärken mit einem Schwerpunkt auf interkulturelle Bildung.
Man kann der Meinung sein, dass die Analyse stimmen mag, aber die Schwerpunkte falsch gesetzt sind. Aber man kann und muss sie als Vorschlag diskutieren, besonders gegenwärtig, da eine politische Diskussion über Schwerpunkte nicht vorhanden ist.
Ob der Kulturbetrieb bei stärkerer Marktorientierung flexibler wird, mag ich nicht zu beurteilen. Kann sein, muss nicht. Seit einigen Jahren schon geht man davon aus, dass Wirtschaftsbetriebe effektiver sind als öffentliche Einrichtungen. Die zurzeit laufende Re-Kommunalisierung beweist das Gegenteil. Manche Kosten werden durch Outsourcing einfach verschoben. Viele Kunsthochschulen arbeiten schon mit Entrepreneurship-Förderung, die Kulturwirtschaftsansätze gibt es (auch bei uns im Norden), sie müssten sicher stärker unterstützt werden. Wenn es eine stärkere Förderung der Laienkultur geben soll, dann brauchen wir eine stärkere Unterstützung der kulturellen Bildung als bisher, gleiches gilt für den interkulturellen Dialog.
Zuzustimmen ist den Autoren, dass bei der Förderung öffentlicher Einrichtungen öffentliches Interesse definiert werden muss. Das ist die Idee des Public Value, die leider in Deutschland bisher zu wenig Beachtung gefunden hat. Wenn wir über Ziele und Wirkungen sprechen, dann sprechen wir über eine aktive Kulturpolitik. Der Artikel ist ja – das wird bei der Kritik oft übersehen – ein Hinweis auf politischen Leerstellen, substanzieller wie struktureller Art.
Die Autoren stellen sich der Diskussion im Nordkolleg
Gestern Abend gab es in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, den Kulturinfarkt zu therapieren. Zwei der Autoren, Stephan Opitz und Dieter Haselbach stellten sich den kritischen Fragen der Kulturredakteure Christoph Munk (Kieler Nachrichten) und Michael Stitz (SHZ). Opitz und Haselbach zeigten sich von den heftigen Reaktionen überrascht. Ihnen, so Haselbach, sei es darum gegangen, einen Diskussionsprozess anzustoßen. Am Anfang des Gespräches ging es nur darum, ob Stil und Umfang der Präsentation der Thesen nicht etwas überdimensioniert gewesen seien. Insgesamt wurde festgestellt, dass nach gut einer Woche die Debatten sachlicher wurden. Das Buch, so Michael Stitz, habe doch auf einer analytischen Ebene in eine bisher sehr emotional geführte Debatte eingegriffen. Die Frage sei doch, was man nun konkret aus der Analyse, was man nun aus den Thesen zu lernen habe. Sowohl Opitz als auch Haselbach wiesen daraufhin, wie knapp doch die öffentlichen Mittel für die Kultur seien, da wäre es kaum möglich, den Status quo im Bestand zu erhalten – und zwar auf hohem Niveau. Das Buch, so Stephan Opitz, sei ein Versuch, mit dem Finanzproblem, vor dem die öffentliche Hand zweifellos stehe, fertigzuwerden und dabei die Haushälter nicht allein zu lassen. Das Verhältnis der Kultur zu ihrer eigenen wirtschaftlichen Seite gelte es zu entspannen, ergänzte Dieter Haselbach. Christoph Munk kritisierte, die Autoren blieben die Antworten schuldig. Das allerdings, erwiderte Opitz, könne man angesichts der unterschiedlichen Bedingungen im ganzen Land gar nicht leisten. Indikatoren für mehr Geld seien ohnedies nicht in Sicht. Wie sieht es denn mit Neubau des Theaters in Schleswig aus, regionalisierten die Diskutanten das Thema. Ist eine Finanzierung von Bau und Betrieb möglich und sinnvoll?
Munk sah im Buch die Künstler nicht genügend gewürdigt, er sehe deren Rolle nur dem Markt unterworfen. Der Markt, entgegnete ihm Dieter Haselbach, sei nicht so negativ konnotiert, wie die Frage insinuiere. Kunst und Menschsein ist zutiefst miteinander verbunden, von daher, so Opitz, seien Künstler für die Gesellschaft zentral.
Das Gespräch, es dauerte über neunzig Minuten, zeigte, dass die Materie differenzierter zu betrachten ist, als der Artikel im Spiegel suggeriere. Insgesamt verlief die Diskussion sachgerecht, mit einigen Längen und – von Seiten des Publikums – Emotionalität. Fühlbar wurde einmal mehr, wie viel Unsicherheit in der Beschäftigung mit dem Thema Zukunft der Kultur steckt.
Ideen sind da
Der Pauschalität und kategorischen Äußerungen, mit denen die Autoren in ihren schriftlichen Äußerungen agieren, sind sicher dem polemischen Duktus geschuldet. Es gibt im Kulturbetrieb durchaus gute und zukunftsträchtige Ideen, oft generationell bedingt. Nicht überall will man nur das „Mehr“ und häufig gibt es sinnvolle und innovative Überlegungen, mit weniger Struktur mehr Qualität und Zuspruch zu erreichen. Nicht zuletzt ist die Kundenorientierung bei vielen Einrichtungen heutzutage selbstverständlich. Die kritischen Impulse kommen eben nicht nur von außen, wie die Autoren behaupten.
Die sind nicht so offensiv auf dem Markt wie der Kulturinfarkt, vielleicht auch nicht so professionell verfasst, aber durchaus wegweisend und mit konstruktiven Ansätzen. Das Rendsburger Manifest beispielsweise bringt einige Ideen, wie bei uns im Land Schwerpunkte gesetzt werden könnten. Das ist positiv formuliert und spricht von Aufbau, nicht von Abbau. Dabei werden Posterioritäten nicht verschwiegen, die gehören zur Schwerpunktsetzung immer dazu. Außerdem ist nicht von der Hand zu weisen, dass es zweifellos attraktive und nachfrageorientierte Kulturangebote geben kann, wie zum Beispiel das Kieler Theater seit Jahren unter Beweis stellt. Das angelsächsische Konzept eines Audience development zeigt konstruktive Ansätze, wird aber im Buch leider nicht erwähnt (der kostenfreie Eintritt in die Museen der Insel gilt als Beispiel für das verzweifelte Ringen nach Besuchern, ein Schuh wird freilich erst daraus, wenn man den freien Eintritt mit dem Konzept einer Bildung der möglichen Kulturrezipienten verknüpft).
Thesen sind dazu da, sie zu diskutieren.
Die erwartbare Apologetik der Kulturszene war, so wie sie erfolgt ist, leider eher eine Affirmation der Thesen als eine kritische Auseinandersetzung. Zuspitzungen sind dafür da, dass man sie aufgreift, um ihren wahren Kernen heraus zu schälen. Das ist leider in vielen Fällen nicht erfolgt. Gefragt ist jetzt kein Abbruchunternehmen, sondern eine Reflexion der Analyse zum Aufbau einer aktiven Kulturpolitik.
Die einzige Kritik, die am Ende am Kulturinfarkt verfängt, ist doch die, dass Verwaltungsmenschen und PolitikerInnen, die wenig Ahnung und keinen Sensus für Kunstszene und Kulturpolitik haben, das Buch als Basis nehmen könnten, um jetzt erst recht Kürzungen einzufordern. Schließlich haben ja Kulturleute die Thesen verfasst, und wenn die schon kritisch sind, dann darf man es von der Steuerungsseite her auch sein. Es wäre fatal, wenn das Buch, anstatt eine wirklich substanzielle und nötige Diskussion über die zukünftige Gestaltung von Kulturpolitik und Kulturinvestitionen zu befördern, genau das Gegenteil bewirkt, nämlich, dass man sich jetzt keine innovativen Gedanken auf breiter Basis mehr macht, weil ja alles schon gesagt ist – und zwar von Fachleuten.
Insgesamt sind die Thesen des Kulturinfarkts ein guter Aufschlag zu einer notwendigen Diskussion, die eh in Zukunft durch eine immer stärker werdende Digitalisierung befeuert wird. Wohin es dadurch geht, ist bisher kaum abzusehen. Die Beschäftigung damit wird spannend – so spannend, wie Kultur sein soll.
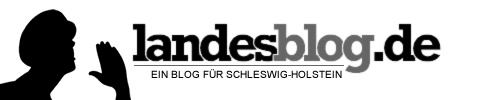
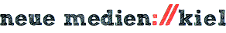

Pingback: Der Kulturinfarkt? Ein Apropos | bildungsweg