Siegfried Fries / pixelio.de
Am Donnerstag berichtet die shz über einen neuen Trendsport bei Verweigerern der neuen elektronischen Gesundheitskarte (eGK), die die bisherige Krankenversichertenkarte ablösen soll: das Einsenden offensichtlich und weniger offensichtlich falscher Fotos. Von Micky Maus, über Darth Vader bis hin zu Abbildern von Schauspielern gäbe es alles. Da es keine gesetzliche Vorgabe gibt, wie das Foto ausgestaltet zu sein hat, gebe es auch kreativere Ansätze. Die shz zitiert Sebastian M., der ein Bild von sich aus dem Skiurlaub, inklusive dunkler Skibrille und Schutzhelm, eingeschickt haben will. Aber woher rührt diese Ablehnungshaltung gegenüber der neuen Gesundheitskarte, dem zweiten großen bundesdeutschen Chipkartenvorhaben neben dem neuen Personalausweis?
eGK — was ist das überhaupt.
Das Bundesministerium für Gesundheit nennt vor Allem drei übergeordnete Ziele, die mit der Einführung der eGK erreicht werden sollen: eine Qualitätssteigerung bei der Patientenversorgung, eine gesteigerte Effizienz in Bezug auf die Kommunikations- und Verwaltungsprozesse und letztlich eine verbesserte Datensicherheit.
Um diese Ziele zu erreichen umfasst die eGK in der aktuellen Form im Wesentlichen folgende fünf Funktionen, respektive Merkmale:
1. Die Onlineverwaltung der Versichertenstammdaten
Zu den Stammdaten eines jeden Versicherungsnehmers gehören Name und Geburtsdatum, Geschlecht, aktuelle Adresse, die Versichertennummer und der Status des Versicherten (Student, Mitglied, familienversichert, Rentner), sowie der Zahlungs- und Zuzahlungsstatus.
2. Europäische Gesundheitskarte, EHIC (European Health Insurance Card)
Innerhalb der EU, sowie den Partnerstaaten Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz, wird die eGK auch als EHIC fungieren und damit den, jedem Bundesbürger der Älter als 25 ist mindestens aus der Werbung bekannten, Auslandskrankenschein ersetzen.
3. Verbesserter Datenschutz
Die bisherige Krankenversichertenkarte ist ziemlich nah am worst case scenario in puncto Datensicherheit angesiedelt. Sämtliche Daten werden unverschlüsselt und ohne vorgeschaltete Schutzfunktion auf ihr gespeichert. Die neue eGK soll nur in Verbindung mit einer PIN nutzbar sein und ist, wie auch EC- oder Kreditkarten im Falle des Verlustes zentral sperrbar, um Missbrauch zu verhindern.
4. Lichtbild
Auf der Vorderseite der Karte soll, ein Lichtbild des Versicherungsnehmers prangen, was die Identifikation des Patienten erleichtern soll.
5. Notfalldaten
Die so genannten Notfalldaten sind die ersten wirklich kritischen Daten. Sie umfassen Daten zur medizinischen Vorgeschichte wie z.B. Allergien, eine Liste mit notfallrelevanten Medikamenten, sowie die Kontaktdaten des „Hausarztes” inklusive bis zu 20 seiner letzten Diagnosen. Darüber hinaus ist es möglich, weitere eventuell wichtige Informationen wie die Blutgruppe zu speichern.
Mit Einwilligung des Patienten können außerdem der Verwahrungsort einer Patientenverfügung, sowie der Organspenderstatus auf ihr vermerkt werden.
Diese Daten sind natürlich äußerst sensibel und ihre Speicherung auf der Karte ist freiwillig. Sie werden sie nicht nur durch eine PIN geschützt. Wer sie auslesen möchte, braucht ein spezielles mobiles Chipkartenlesegerät, sowie einen speziellen Heilberufsausweis, um auf die Daten zugreifen zu können. Das gilt nicht nur in Arztpraxen und Notaufnahmen, sondern auch für Notärzte und Rettungssanitäter.
Was soll noch kommen?
Noch in Arbeit sind im Wesentlichen drei weitere Funktionen der eGK: der elektronische Arztbrief, das elektronische Rezept und die elektronische Patientenakte.
Der elektronische Arztbrief ist dabei Bestandteil der elektronischen Patientenakte. „Der Arztbrief ist eine Form der Information für den einweisenden Arzt oder Zahnarzt, der eine Einweisung in ein Krankenhaus oder eine andere Ärztliche Behandlung im ambulanten Bereich eine Überweisung veranlasst hat bzw. für den weiter behandelnden Arzt, der die weitere Behandlung übernimmt.” (Wikipedia).
Die Funktionsweise als elektronisches Rezept soll den Weg von der Diagnose bis zur Ausgabe eines Medikaments effizienter gestalten. Das Rezept wird nicht mehr mit einem Nadeldrucker oder gar handschriftlich ausgestellt, sondern auf der eGK gespeichert, so dass der Apotheker es schnell und unkompliziert auslesen kann. Außerdem fällt der Schritt der Digitalisierung des eingelösten Rezepts für den Apotheker weg.
Gewissermaßen der heilige Gral der eGK ist die elektronische Patientenakte. Sie ist genau das, was man sich unter dem Begriff vorstellt. Nämlich das digitale Pendant zu den Aktenordnern, bzw. Hängeregistern, die derzeit jeder Arzt über jeden seiner Patienten führen muss.
Und was ist daran zu kritisieren?
Das grundlegende Problem der eGK ist, dass sie selbst zu wenig Speicherplatz aufweist, um all diese Daten vorrätig zu halten. In den 32 Kilobyte(!) finden gerade einmal die Stammdaten, die Notfalldaten und bis zu acht Rezepte Platz.
Alle anderen Daten werden online gespeichert. Mit der Einführung dieser über die Grundfunktionen hinausgehenden Funktionalitäten geht also die Einführung einer komplexen Telematikinfrastruktur einher. Mit dem Aufbau dieser Infrastruktur wurde die Firma gematik beauftragt.
Wobei es selbst wenn alle Daten ausschließlich auf der Karte lägen fraglich wäre, wie sicher diese mit einer einfachen PIN wirklich sind. Hier wäre zur Authentifizierung eventuell eine Koppelung an den (ebenfalls in der Kritik stehenden) neuen Personalausweis denkbar.
Daten, die Gold wert sind, auf dem silbernen Tablett?
Gerade die jüngste Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass Datenbanken dazu neigen abhanden zu kommen. Nicht nur die Telekom und Sony mussten das schmerzhaft feststellen. Die Krankendaten von über 80 Millionen Bundesbürgern, die alle zentral zugänglich sind, dürften dabei noch wertvoller als Telefonrechnungen, Login- oder Kreditkartendaten sein. Nicht nur Werber von Pharmakonzernen dürfte es interessieren, wem man Produktinformationen zu den eigenen Präparaten zukommen lassen sollte und wo es sich vermutlich nicht lohnt. Auch einen potenziellen neuen Arbeitgeber dürfte es brennend interessieren, dass der Bewerber zuletzt im Schnitt fünf Wochen im Jahr krankheitsbedingt abwesend war oder an einer schweren Krankheit leidet, die sein Leistungsvermögen sukzessive mindern wird.
Aber wie wahrscheinlich ist das Abhandenkommen dieser Daten?
Selbstverständlich werden sämtliche Daten, die ein Arzt zum Server übermittelt mit einem kryptographischen Schlüssel, der auf der eGK enthalten ist, verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Grundsätzlich müsste ein „Datendieb” also nicht nur in den Besitz eines speziellen Karten-Terminals sondern auch in den Besitz der eGK seines potenziellen Opfers gelangen, um an die wertvollen Daten zu kommen.
Fast richtig. Die informationstechnische Servicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH hat nämlich die Möglichkeit zu jedem Schlüssel einen Nachschlüssel anzufertigen. Einem Eindringling in dieses System wäre es gegebenenfalls möglich sämtliche Schlüssel auszulesen. Sollte dies gelingen, ist der Schritt zu den eigentlichen Daten nicht mehr weit.
Ferner liegt nach Wissen des Autors bisher keine veröffentlichte Nachweisführung vor, dass die eGK die Anforderungen zum Stand der Technik nach den international gültigen und vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) mit verfassten Normen (ISO/IEC 15408) erfüllt.
Ein weiterer Angriffsvektor sind die Geräte, die bei den Ärzten und Apothekern stehen. Um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren müssten sämtliche Ärzte und Apotheken dedizierte, vom restlichen Praxis-/Apothekennetzwerk getrennte Computer vorhalten, um auf die Daten von Karte und Server zuzugreifen. Wünschenswert wäre sogar eine eigene Internetanbindung für diesen Rechner über die der Transfer der Daten über einen gesicherten VPN-Tunnel geschieht.
Ob die Notwendigkeit dieser Maßnahmen von allen Ärzten und Apothekern eingesehen und die dadurch entstehenden Mehrkosten für ein Mehr an Sicherheit akzeptiert werden, ist stark zu bezweifeln wenn man einen Blick auf die heutige „IT-Realität” in viel zu vielen Praxen und Apotheken wirft.
Kritik auch vom Ärztetag
Auch der deutsche Ärztetag spricht sich seit 2007 regelmäßig gegen die eGK aus. Zuletzt geschah dies im Mai 2012, wenn auch nur mit knapper Mehrheit. Der gigantomanische Anspruch, durch eine flächendeckende Elektronifizierung der Patientenversorgung unter Führung der Krankenkassen sowohl transparente Patienten wie auch transparente Ärzte herzustellen, widerspreche elementaren ärztlichen Grundwerten heißt es in einer Erklärung. Grundsätzlich werde jede Form der Sammlung medizinischer Daten in zentralen Serverstrukturen abgelehnt. Insgesamt erklärte der Ärztetag das Projekt für gescheitert.
Kann man sich dagegen wehren?
Der Zug ist sicherlich abgefahren. Zu lange ist dieses Großprojekt schon in Gange, zu viel Geld wurde bereits investiert. Der Protest, dem durch das Nichteinsenden eines brauchbaren Fotos Ausdruck verliehen wird, dürfte auch nicht mehr als ein Sturm im Wasserglas sein. Sicherlich, nach § 291 Absatz 2 SGB V muss eine eGK ein Lichtbild des Versicherten enthalten und die Krankenkassen dürfen ohne Lichtbild keine Karte ausstellen. Solange man noch eine alte gültige Krankenversichertenkarte hat, wird dies auch nicht zu Problemen führen. Läuft diese allerdings ab und man kann beim nächsten Arztbesuch keine gültige Versichertenkarte vorweisen, so kann der Arzt die Behandlung verweigern, respektive eine Privatrechnung ausstellen. Darauf weist auch der eGK-kritische CCC ausdrücklich hin.
Wie geht’s weiter?
In Anbetracht des aktuellen Standes des Projekts ist jede Form der Fundamentalopposition, auch die des Ärztetages, dabei jedoch ebenfalls kritisch zu hinterfragen.
Sinnvoller wäre es sicherlich die Existenz der eGK zu akzeptieren, Vor Allem, da die aktuellen Funktionen die der bisherigen KVK nicht wirklich übersteigen. Von dort aus können sich dann alle Beteiligten konstruktiv mit den noch ausstehenden Funktionen beschäftigen — denn letztlich stehen ja auch nur die wirklich in der Kritik.
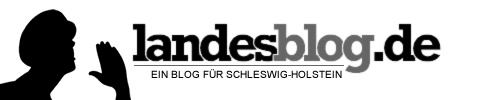
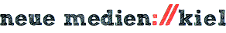

Ich warte noch auf die Gewinnausschüttung durch die Einführung der aktuellen Karte. Da war auch die Rede von Kostensenkung — finanziert durch die Versicherten (wen sonst).
Dann mach ich auch reibungslos mit und sehe der Halbierung der mtl Versicherungsbeiträge entgegen.
Abgefahren ist nicht „der Zug”, sondern der Mitmacgappell
Es gibt auch eine Chaosradio-Sendung zum Thema. Die ist zwar aus dem Jahr 2006 und darum nicht mehr in allen Details aktuell, unter anderem weil viele angedachte Funktionen erst einmal nicht realisiert werden sollen. Es wäre aber nicht das erste Mal, wenn zu einem späteren Zeitpunkt über deren Nachrüstung erneut nachgedacht wird.
Zum Podcast: http://chaosradio.ccc.de/cr115.html