
By: Rising Damp - CC BY 2.0
13.000 Plastikmüllpartikel treiben durchschnittlich auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche, so die Schätzungen des Umweltbundesamtes. Viele dieser Kunststoffteile stellen eine Gefahr für das Leben im Meer dar, vor allem Verpackungsmaterial und Überbleibsel aus dem Fischereibetrieb. Die Veranstaltungsreihe „Plastik im Meer“, die in dieser Woche in Kiel statt findet, will auf diese Belastungen aufmerksam machen. Einer der Referenten ist Dr. Mark Lenz vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Sein Vortrag läuft am 28. November 2014, um 17:00 Uhr in der Kieler Stadtbücherei im Neuen Rathaus – ich konnte mich schon vorher mit ihm unterhalten.
Plastik hat enorme Vorteile – die Probleme sind Menge und Verwendung

Dr. Mark Lenz ist 1971 in Kiel geboren. Er ist Diplom-Biologe, der 2003 an der CAU im Bereich Zoologie promovierte. Seitdem liegt sein Arbeitsschwerpunkt auf der Meeresökologie. Seit 2004 ist er am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung beschäftigt, wo er das internationale Forschungs- und Ausbildungsprogramm GAME koordiniert. Seit 2013 befasst sich das Team mit dem Thema Mikroplastik im Meer.
Dr. Lenz, der Titel ihres Vortrags lautet „Der Ozean als Müllhalde: Wie gefährlich ist Plastik für Meeresorganismen?“ Wie weit sind Sie mit der Beantwortung dieser Frage?
Unsere Gruppe hier am GEOMAR ist seit zwei Jahren an dem Thema dran. Wir arbeiten im Rahmen eines internationalen Forschungsprogramms, bei dem wir mit Partnerinstituten auf der ganzen Welt kooperieren. Was schon ganz gut untersucht ist, sind die Auswirkungen von großen Plastikteilen im Meer, wie etwa Netze oder Plastiktüten, die von Organismen verschluckt werden bzw. in denen sich die Organismen verfangen und dann sterben, weil sie verhungern oder ersticken. Die Auswirkungen der sogenannten Mikroplastiken kennt man dagegen noch nicht so gut. Da fehlen noch wichtige Grundlagen und da sind wir jetzt dran.
Stichwort Grundlagen: Was ist überhaupt Plastik?
Eigentlich ist es Erdöl, nur in einer anderen Form. Zum Teil wird auch Erdgas oder Kohle benutzt. Es sind Kohlenstoffketten, die eine Molekülmatrix bilden, die entsprechend ihrer Verwendung besondere Eigenschaften hat. Deshalb ist Plastik so beliebt: es ist stabil, langlebig, flexibel, leicht und billig. Man kann es kostengünstig herstellen und für alles Mögliche einsetzen.
Also wird immer neuer Plastikmüll entstehen, oder gibt es Alternativen?
Plastik hat enorme Vorteile. Die Probleme sind Menge und Verwendung. Man könnte sich z.B. fragen, ob man Plastik in diesem Umfang für Einwegverpackungen einsetzen muss. Wichtig sind auch Müllströme und Müllmanagement. Hier bei uns gibt es kaum Verluste, d.h. es wird selten etwas in die Umwelt getragen. In vielen Schwellenländern wird auch massiv Plastik gebraucht und konsumiert, aber dort sind die Entsorgungssysteme oft nicht gegeben. Da müssen technische Lösungen gefunden werden. Gleichzeitig muss man versuchen in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Entsorgung zu entwickeln. Wir haben beispielsweise ein Projekt von einer unserer Doktorandinnen, die in Indonesien eine Organisation aufgebaut hat, die in einer Kommune eine Müllentsorgung auf die Beine gestellt hat: Eigentlich ein Mann mit seiner Mofa und einem Anhänger. Der fährt da einmal die Woche rum, sammelt den Müll ein und fährt ihn zu einer professionellen Verbrennung. Das bringt unheimlich viel. Bislang haben die Leute das dort in ihrem Garten gemacht.
Das Material ist also nicht so sehr ein Problem, wie der Umgang damit?
Genau. Ich habe z.B. auch mal mit Leuten aus der Plastikindustrie gesprochen. Die sagen auch, dass ist nicht unser Problem. Es ist der Verbraucher, der nicht sorgfältig damit umgeht. In Deutschland, ok. Wenn hier jemand seine Plastikflasche einfach irgendwohin wirft, dann ist das unverantwortlich, aber in Ländern in denen es keine gut organisierte Müllentsorgung gibt, können die Leute auch wenig machen.
Mikroplastik – winzige Teilchen im Mikrometerbereich
Woher kommt Mikroplastik?
Einmal durch den Zerfall von größeren Plastiken. Wenn Sie beispielsweise eine Plastikflasche ins Meer werfen, dann wird sie nach einiger Zeit zerfallen und zerbricht in kleinere Teile und dieser Prozess setzt sich immer weiter fort. Es gibt auch kleine Plastikfragmente, die extra so produziert werden, Rohplastiken etwa. Ein Teil davon gelangt in die Umwelt, z.B. beim Verladen oder bei Containerhavarien. Die dritte Quelle von Mikroplastik sind Kosmetikprodukte oder Kleidung: Fleecepullover sondern Fasern beim Waschen ab und bei der Kosmetik sind es etwa Peeling- oder Zahnpflegeprodukte. Die kleinen Plastikfragmente in diesen Produkten werden von unseren Kläranlagen nicht zurückgehalten und gelangen so über Abwässer wieder in die Flüsse und ins Meer.
Man hört immer wieder von speziellen Zusätzen, wie etwa Weichmacher. Was ist das?
Wenn man Plastik verarbeitet, um es in Form eines Produktes nutzen zu können, muss man seine Eigenschaften modifizieren. Da gibt es verschiedene Zusätze, die beispielsweise verhindern, dass das Plastik spröde wird oder die ihm eine bestimmte Farbe verleihen. Dafür werden sogenannte Additive benötigt, zu denen auch die Weichmacher gehören. Diese chemischen Verbindungen werden auch wieder ausgewaschen, wenn Plastik ins Meer gelangt. Ein Zusatz heißt z.B. Triclosan. Der verhindert bakterielles Wachstum und ist interessant für Lebensmittelverpackungen.
„Schleswig-Holstein Meer umschlungen“ heißt es in unserer Landeshymne. Wie sieht es mit der Plastikbelastung in Nord- und Ostsee aus?
Wir haben hier selbst mal gefischt und Sedimentproben entnommen. Man findet immer irgendetwas. Es ist aber recht wenig. Vor allem Fasern, die vermutlich von Schwimmleinen oder Netzen stammen. In der Elbmündung haben wir auch mal Partikel aus Zahnpasta gefunden. Die Belastung ist schon da, bei uns aber noch relativ gering, unter anderem, weil wir verglichen mit anderen Ländern ein gutes Müllmanagement haben.
Fischen bedeutet Beifang
Welchen Schaden richtet Plastik im Meer an?
Das ist sehr vielfältig. Eine Sache ist, das Plastik in sehr vielen unterschiedlichen Größen im Meer vorkommt. Von riesigen Planen bis hin zu mikroskopisch kleinen Partikeln d.h. Plastik kann mit allen möglichen Tieren und Pflanzen interagieren. Relativ gut sind die Auswirkungen großer Plastikteile auf große Organismen untersucht. Wale, Delphine, Seehunde, Seevögel usw. Sie können sich darin verfangen oder es mit Nahrung verwechseln. Das kann zu Darmverschluss oder einer Pseudosättigung führen. Das ist ein häufiges Phänomen bei Seevögeln. Die füttern auch ihre Jungen mit Plastik und die Tiere verhungern dann noch im Nest. Ein anderes Problem, ist das der sogenannten Geisternetze: Also Fischereinetze, die im Meer aufgegeben oder verloren wurden und in denen sich Tiere verfangen. Entsprechend interagiert Mikroplastik mit Kleinstorganismen, die viel weiter unten in der Nahrungskette stehen und die auch eine andere ökologische Rolle haben, weshalb die Auswirkungen da sogar noch dramatischer sein könnten.
Gelangt Plastik über die Nahrungskette auf unsere Teller, z.B. wenn wir Fisch essen?
Meistens, wenn Tiere Mikroplastik aufnehmen, geht es durch sie einfach durch. Es geht über den Magen-Darm-Trakt. Es gibt die Möglichkeit, wenn das Plastik entsprechend klein ist, das es durch die Darmwand ins Gewebe gelangt und dort kann es Entzündungsreaktionen auslösen. Was noch diskutiert wird, ist dass Plastik Schadstoffe akkumuliert. Heißt: Plastik funktioniert wie ein Magnet. Organische Schadstoffe oder Rückstände aus der Ölverbrennung lagern sich an Plastik an. Es fungiert somit als Träger für Schadstoffe, die dadurch von den Tieren in hochkonzentrierter Form aufgenommen werden können – im Gegensatz zu Schadstoffen im Meerwasser, die dort nur relativ verdünnt auftreten.
Wie bekommt man Plastikmüll wieder aus dem Meer?
Nur sehr schwer. Es gibt Überlegungen das Plastik abzufischen, was mehr oder weniger sinnvoll ist, denn es ist immer Fischerei – und die ist unvermeidbar mit Beifang verbunden. Das heißt, wenn Sie im Meer nach Plastik fischen, fischen Sie auch alles andere raus, was ähnlich groß ist und sich ähnlich verhält. Deshalb muss man die ökologischen Folgen gegeneinander aufrechnen. Wenn ich Plastik aus dem Meer fische, wie groß ist der Nutzen im Verhältnis zu dem Schaden, den ich dadurch anrichte, dass ich viele Organismen mit abfische? Aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Man muss erst den Neueintrag verhindern. Solange Plastik ins Meer gelangt, wäre Abfischen eine Sisyphosarbeit. Mikroplastik aus dem Meer zu fischen ist völlig illusorisch, es ist zu klein.
Gibt es andere Optionen?
Es gibt ein paar Bakterienstämme, die Plastik metabolisieren können, aber nur sehr geringfügig. Außerdem ist das Meer in der Hauptsache dunkel und kalt und da arbeiten diese Bakterien nur sehr langsam. Das Meer ist eine gute Umwelt, um Plastik zu konservieren. Es ist aber auch nicht so, dass alles voll von Plastik wäre. Es ist schon in der Wassersäule und im Sediment verteilt. Da liegt oder schwimmt nicht Plastikstück auf Plastikstück. Höchstens an sehr extremen Standorten.
Die da wären?
Es gibt z.B. Daten von Hawaii. Die Inseln liegen in der Nähe eines Müllstrudelgebietes im Pazifik. Dort hat man festgestellt, dass 3 % des Strandsandes aus Plastik bestehen. Das ist aber auch ein Maximalwert, so was findet man nicht überall.
Was kann jeder Einzelne im Alltag für ein Meer ohne Plastik tun?
Man sollte sich z.B. fragen, wo kann ich auf Plastik verzichten? Eine andere Sache wäre die Teilnahme an Müllsammel-Aktionen. Die werden oft von Umweltverbänden organisiert. Müll einfach einsammeln, der am Strand liegt, ist generell ein sehr praktischer Beitrag. Es gibt auch viele gute Projekte, auf die man aufmerksam machen kann, wie etwa das Greenscreen Festival. Grundsätzlich muss man mehr auf die Problematik aufmerksam machen, sensibilisieren und aufklären.
… und da leistet die Aktionswoche „Plastik im Meer“, die noch bis zum 29. November 2014 in Kiel läuft, sicher einen Beitrag. Dr. Lenz, vielen Dank für das Gespräch.
Links:
Forschungs- und Ausbildungsprogramm GAME
Forschungs- und Ausbildungsprogramm GAME/FACEBOOK
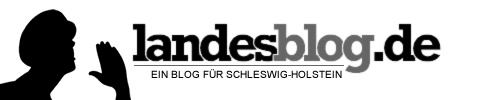
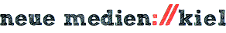

Was mich interessiert: Wie und wo gelangt denn primär Plastiktüten ins Meer? Ich kann mir nämlich kaum vorstellen, daß eine Tüte, die ich bei Einkäufen und später ggf. als Abfallbeutel etc. verwende (und die dann irgendwann in der Müllverbrennung landet) die Nordsee vollmüllt. Und auch wenn es sicher auch Leute gibt, die acht- und sorglos auch hierzulande Plastikflaschen und -tüten ins Meer werfen: Sind das dann in Menge die großen schädlichen Einträge, deretwegen solche Tüten dann hier geächtet/verboten werden sollen? Oder kommt das Gros des Schadeeintrages aus anderen Quellen (=so daß ein Platstiktütenverbot hier letztlich sinnfrei, weil bestenfalls symbolisch wäre (mit Blick auf Plastikmüll als Meeresschädigung betrachtet, unabhängig von der Rohstoff-Frage)?
Ich sehe es ähnlich wie Stecki — das Problem sind nicht primär die Plastiktüten, die ins Meer gelangen. Trotzdem ist es sinnvoll irgendwo anzufangen. Und Plastiktüten sind einfach überflüssig, wenn man mal anfängt sich mit dem Heimtransport seiner Lebensmittel zu beschäftigen. Geht nämlich auch ganz einfach ohne. Also fangen wir da mal an! Ich habe aber z. B. auch angefangen Q-Tipps nur noch mit Stäbchen aus Papier zu kaufen. Sind unbedeutend teurer und lösen sich im Wasser auf. Die Plastikstäbchen hingegen findet man immer wieder im Verdauungstrakt von Meeresbewohnern. Sich mit unschönen Dingen aktiv beschäftigen und kleine Schritte machen — hilft immer!
Thanks for finally writing about >Die Plastiksee — Fragen und Antworten zur Belastung
durch Kunststoffmüll im Meer