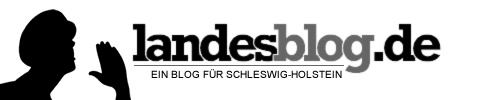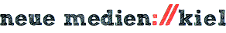„Odin hrafnar“ von Ranveig, lizenziert unter Wikimedia Commons. Odins Raben Hugin und Munin sind Wappenvögel des Danevirke Museums.
Nis Hardt räumt auf in der Mottenkiste unserer Klischees über Wikinger, Haithabu und das größte und älteste archäologische Baudenkmal Skandinaviens, das Danewerk. Im Gespräch mit Melanie Richter und Daniela Mett erklärte der Archäologe und Direktor des Danevirke Museums die Bedeutung unseres Kulturerbes für Europa.
Das Danewerk bildete einen Riegel quer über das Land von Hollingstedt bis Haithabu. Man geht davon aus, dass es bloß einen Durchweg im zentralen Teil des Hauptwalls gab — das 2010 bei Grabungen freigelegte Wieglesdor. An dieser Stelle wurde der Wall am häufigsten umgebaut und verstärkt. Also war das Ziel die Schaffung einer Handelsbarriere?!
Nis Hardt: Alle sagen, ja ist doch klar, dort musste jeder durch. Früher kreuzte der Heerweg, später Ochsenweg genannt, heute verlaufen dort Bahntrasse und Autobahn. Aber wir vergessen dabei, dass ein Großteil des Warentransports noch vor gut hundert Jahren per Schiff erfolgte. Dass wir hier einen Wall vorfinden, hat etwas mit seiner geografischen Lage zu tun. Hier sind Nord- und Ostsee einander am nächsten. Im Westen reichen zwei natürliche Wasserstraßen weit ins Land, die Eider und Treene, im Osten die Eckernförder Bucht und die Schlei. Dazwischen befindet sich eine Landbrücke von ungefähr 10 Kilometern Länge. Der Handel zwischen dem Baltikum und den dahinter liegenden Ländern bis runter nach Irak zu den Kalifen, der musste hier durch. Das war der kürzeste Weg. Sonst hätte man durch das dänische Reich und rund um Skagen segeln müssen. Heute stellt der Nord-Ostsee-Kanal diese Verbindung her.
Vor wem hätte man diese Querverbindung schützen müssen?
Nis Hardt: Am Fuß der jütländischen Halbinsel wurden im frühen Mittelalter verschiedene Völker ansässig. Im Norden siedelten Angeln und Jüten. Vor 700 kamen die Danen hinzu. Die Angeln und Jüten gingen in diesem Verband auf. Zur selben Zeit zogen Friesen nördlich des Danewerks an die Westküste. Südlich vom Danewerk lebten sächsische Stämme, die Dithmarscher, die Holsaten, die Stormaner. Das Gebiet östlich der Kieler Förde wurde von Slawen bewohnt. Was daraus folgte, waren endlose Querelen um die Grenzsicherung des karolinigschen Reiches. Erst versuchten die Franken, den Rest Holsteins an Slawen abzutreten, um eine Pufferzone zu den Dänen zu haben. Als das nicht hinhaute, wurden die letzten nordelbischen Gebiete, in denen noch freie Sachsen wohnten, von den Karolingern miterobert. Die errichteten dann die ersten Festungen. So kommt es, das um 800 Karl der Große und König Gudfred einander plötzlich hier an der Eider begegnet sind. Das Danewerk bildete die Grenze zwischen beiden, dem dänischen Reich und dem Reich der Karolinger. Es hielt das Hinterland frei. Jenseits des Walls herrschten andere Regeln, galten andere Gesetze.
Der Wall konnte unmöglich auf gesamter Länge bewacht werden, wieso ging man davon aus, sich damit vor Eindringlingen schützen zu können?
Nis Hardt: Die angelsächsischen Könige machten es vor. Sie hielten damit die Cornwelschen und die Walliser ab. Als 450 nach Christus das weströmische Reich kollabierte, setzten Jüten, Angeln und Sachsen nach Britannien über. Die letzten, von Römern besetzten Provinzen werden von Germanen übernommen. Und dann kreuzt um 500 in den Quellen erstmals ein politischer Verband auf, den sie die Danen nennen. Sie werden neben den Goten erwähnt. Franken erschlagen 516 am Strand in Nordfrankreich einen dänischen Königssohn. Davon erfahren wir aus den fränkischen Reichsannalen. Es ist sicher kein Zufall, dass in der Folge die Idee aufkommt, eine Verteidigungslinie gegen Süden zu errichten. Normalerweise ereignet sich eine Invasion ja nicht so rasch. Früher stellte man dem potentiellen Feind Geiseln, d.h. der fremde Königssohn wuchs beim gegnerischen Machthaber auf oder man schloss Allianzen etwa durch Heirat.
Blitzartig zuschlagen konnten doch auch die Wikinger…
Nis Hardt: Sofern der Wind richtig stand, waren die innerhalb von zwei Tagen drüben in Britannien, um mit einer Besatzung aus nur vier Schiffen alles platt zu machen und wieder abzuhauen. Richtige Kriege dagegen haben Vorbereitung gekostet. Wichtig war, erst die Ernte einzubringen, bevor man sich in solche kriegerischen Geschichten einließ. Andererseits war man darauf angewiesen, dass auch der Feind geerntet hatte, so dass man seine Vorräte plündern konnte. Es gab vorab immense logistische Aufgaben zu lösen. Zur Aufstellung einer Abwehr blieb also Zeit. Durch den Graben macht die Front zudem einen enormen Geländesprung, den der Feind mit Waffen überwinden muss. Eine Ausrüstung der damaligen Zeit wiegt um die 40 Kilo. Schlepp das mal und versuch, damit über den Wall zu stürmen.
Wenn die mit Wasser gefüllt wären, hätten sich Handelsschiffe darauf entlang treideln lassen…
Nis Hardt: Es gibt immer wieder Spinner, die behaupten, das Danewerk wäre kein Verteidigungswall sondern ein Kanal, eine Schiffszuganlage sozusagen, ein Treidelweg. Dabei haben die Gräben, die vor dem Danewerk liegen, nie Wasser geführt. Warum sieht der Kanal aus wie ein Wall? Er erreicht eine Höhe von sieben Metern! Die Waren wurden in Haithabu gelöscht und über Land zur Treene gebracht, um dort auf das nächste Schiff verladen zu werden. So wie ein Containerterminal muss man sich das vorstellen. Die Schiffe über Bohlen ziehen, das konnten sie im Mittelalter bereits. Wir wissen aus einer Quelle, dass Sven Grate um das Jahr 1130 Schiffe von der Schlei bis nach Hollingstedt ziehen lässt. Das tut er, weil ihm sein Vetter Knut die dänische Krone streitig macht und er den Widersacher in der Südermarsch angreifen will. Kriegsschiffe, die 60 – 80 Mann Besatzung hatten, konnten sie aus dem Wasser kriegen. Aber ein Handelsschiff, das allein schon aus 8 Tonnen Eiche besteht, 4 Tonnen Steine als Ballast hat, und von 5 Mann Besatzung gesegelt wird, zieht man nicht aus der Treene und schiebt es mal eben so nach Haithabu. Allein der Geländeunterschied beträgt 7 Höhenmeter über den Korridor.
Welche Waren lohnten den weiten Weg? Im schwedischen Birka wurde bei Grabungen eine Buddha-Figur gefunden.
Nis Hardt: „Ware“ ist ein merkwürdiger Begriff im Zusammenhang mit vorkapitalistischen Gesellschaften. Da Sachen des alltäglichen Gebrauchs selten Spuren hinterlassen, ist Ihre Frage schwer zu beantworten. Im Brunnen von Haithabu fand man Walnüsse und Pflaumensteine und Hopfen, der damals bei uns noch nicht angebaut wurde. Denkbar wären vorgearbeitete Erze wie Metall, Silber und Gold für Schmuck. Eisen wurde zur Waffenherstellung gebraucht, bestimmte Holzkohlesorten, um Schmiedearbeiten durchführen zu können, auch Bernstein und teure Felle. Leder brauchten sie für alles mögliche, später wohl auch Hölzer, als Baumaterial. Mitte des 12. Jahrhunderts kommt dann über Hollingstedt Tuffstein zu uns, auch Getreide aus verschiedenen Gebieten. Die erwähnte Buddha-Figur stammt aus der Wikinger-Zeit, als eine Verbindung zum heutigen Irak bestand. Von hier aus reichten weitere Handelsrouten nach Fernost. Aus dieser Periode haben wir zig arabische Münzen bei uns gefunden. Sie waren Zahlungsmittel. Mit den Arabern lief der Handel deshalb so gut, weil die so viel Silber besaßen.
Haithabu gilt als wichtiger Handelsplatz der Wikinger…
Nis Hardt: Weil es sich gut macht im Marketing. Tatsächlich haben wir um 740 n. Chr. eine multikulturelle Gesellschaft an der Schlei. Wie viele Menschen, lässt sich schwer sagen. Aber man sollte sich nicht mehr als ein paar Tausend vorstellen. Sie lebten in ihren Werkstätten. Das waren sogenannte Grubenhäuser, in den Boden eingesenkte Hütten. Wir wissen nicht einmal, ob deren Bewohner das gesamte Jahr über dort gelebt haben. Aber wir wissen von innerstädtischen Reibereien mit bereits getauften Friesen und Sachsen aus Gebieten nördlich der Elbe. Die Siedlung lag südlich des Danewerks und damit in einem eigenen Gerichtsbezirk. 845 – 850 durften Christen in Haithabu eine Kirche errichten. Nach katholischem Brauch bimmelte deren Glocke stündlich. Da bekommt doch jeder, nicht nur Heiden, ein Horn von. Später fand man das Ding in der Schlei, es ist unser ältester Glockenfund im skandinavischen Raum.
Also wurde der Wall als Bollwerk gegen die Christianisierung errichtet?
Nis Hardt: So wie die Sachsen haben sich auch die Danen Jahrhunderte lang gesträubt, diesen Glauben anzunehmen. Harald Blauzahn lässt sich um 965 taufen. Dadurch wird das Christentum zur Staatsreligion und keiner konnte die Danen mehr als Barbaren bezeichnen. Nun waren sie gute Christen. Jedoch bedeutete der Glaube im Mittelalter nicht viel, die Franken haben auch die christlichen Langobarden platt gemacht in Norditalien. Ob Christ oder nicht, verschont wurde keiner, sobald Machtinteressen im Spiel waren. Doch dadurch, dass dänische Könige nun offiziell Christen waren, konnten sie sich mit Töchtern aus christlichen Häusern von Großherrschern vermählen. Das war praktisch für die Diplomatie. Letztlich hat man das Heidentum jedoch nie ausrotten können. Die Skandinavier glauben ja immer noch an Trolle und Nissen und so etwas. Öffentlich waren Opfergaben verboten, aber was man privat machte, das ging keinen etwas an.
Welche Werte galt es gegen die Franken zu verteidigen?
Nis Hardt: Zum Beispiel wurde in Skandinavien nie das Feudalsystem eingeführt. Niemand besaß die Macht, allein über alle zu bestimmen. Selbst Dänemarks Könige wurden gewählt. Wollte einer nicht so, wie man selbst, konnte man ihm nicht einfach auf den Kopf hauen. Das verhinderte ein filigraner Machtapparat. Außerdem hat der Norden nie Leibeigene und Untertanen gekannt wie es sie in den südlichsten Teilen von Schleswig gegeben hat. Ein dänischer König konnte seine Soldaten nicht an irgendeinen anderen Machthaber verkaufen oder verleihen.
Darüber wissen wir kaum etwas. Der Norden gilt ja traditionell als wortkarg – ein paar Runen auf Stein, damit war wohl alles gesagt.
Nis Hardt: Erst als sich Klöster etablierten, gab es Stätten zur Aufbewahrung von Schriftstücken. Selbst Waldemar der Große, der die Ziegelsteinmauer hier bauen ließ, lebte in einem Bauernhaus, dessen Wände aus Reisig geflochten und mit einem Gemisch aus Lehm und Kuhdung verschmiert waren. Wie hätte er dort Papiere aufbewahren sollen? Nach wenigen Jahren wären sie weg, wahrscheinlich von Ziegen gefressen. Quatsch ist, dass die Wikinger nicht lesen und schreiben wollten oder konnten und nur Runen in Stein meißeln ließen. Aus späterer Zeit sind kleine Birkenbriefchen erhalten. Darin steht sogar sehr Persönliches: „Erik, besauf Dich heute bitte nicht so doll“ oder „Lieber Onkel, bitte verhau mich nicht, wenn ich zurückkomme, ich kann nichts dafür, dass der Handel nicht so klappte, wie du es Dir vorgestellt hast.“ Hätten sie öfter auf Holz geschrieben, besäßen wir mehr Quellen.
Die Grabungen am Tor sind abgeschlossen. Was kam dabei heraus?
Nis Hardt: Wir fanden einige Tonscherben aus der alten Zeit und aus dem Mittelalter, einen Schleifstein, und wir haben 9 Holzspaten, die noch nicht ganz genau datiert sind, sowie einen Spatenbeschlag. Und es gelang, das legendäre Tor nachzuweisen, dass 808 in den Reichsannalen erwähnt wird. Für die Mauer wurden 20 Millionen Steine von der Ostsee hierher geschafft und bearbeitet, um sie im Fischgrätmuster aufreihen zu können. Die Strandmurmeln gab man in Matten, damit sie sich verhaken, und füllte die Zwischenräume mit einem Gemisch aus Lehm und Sand auf. Es kann durchaus 2 bis 3 Jahre dauern bis die Dokumentation dazu fertig ist. Die große Aufgabe, die vor uns liegt, ist, dieses Bauwerk mit seiner bedeutenden Rolle für die europäische Geschichte zu vermitteln. Und dazu müssen wir im Danevirke Museum eine neue Ausstellung einrichten. Wir konnten in diesem Jahr mit den Illustrationen anfangen und erste Funde ausstellen. Wären wir Weltkulturerbe, fiele es uns leichter, Unterstützung einzuwerben. So fehlt Anerkennung. Einige denken immer noch, das Danewerk wäre nur so ein verkrauteter Knick.
***
Träger des Danevirke Museums ist der SSF Sydslesvigsk Forening, die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit in Deutschland. Im Museum werden zwei Dauerausstellungen gezeigt, eine zum Danewerk, die andere trägt den Titel „Dansk i Sydslesvig“ und erzählt von Dänen, die trotz Trennung von Dänemark dänisch bleiben wollen.
Unter der Führung Islands bewarben sich Kulturpartner aus fünf Nationen, darunter das Danewerk und Haithabu, 2014 gemeinsam um Aufnahme ihrer „Wikingerzeitlichen Stätten in Nordeuropa” in die Unesco-Welterbeliste. Im ersten Anlauf gelang das nicht. Das Komitee forderte 2015 von der transnationalen Gemeinschaft wesentliche Nachbesserungen.
- Danevirke Museum, Ochsenweg 5 in Dannewerk bei Schleswig
- Winterpause vom 01. Dezember 2015 bis 29. Februar 2016, ab 01.03. – 30.4. + 1.10. – 30.11. jeweils Di-So 10 – 16 Uhr, über Sommer geöffnet Mo-Fr 10 – 17, Sa+So 10 – 16 Uhr
- Eintritt: 3 Euro / Erwachsene, 1 Euro / Kind
- Info: 04621/37814 und auf www.danevirkemuseum.de