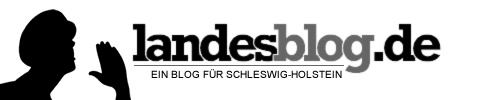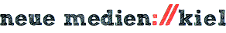Bernhard Schwichtenberg bei "Yes, I have an answer" von Roswitha Steinkopf. Ihrer 2001 in Kiel gestarteten interaktiven Performance schliessen sich weltweit immer mehr Menschen an: www.roswitha-steinkopf.de.
Impulsgeber zu diesem Beitrag war ein Essay von Jochen Gerz über die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft. Den hatte Gerz anlässlich seiner im September 2018 eröffneten Duisburger Ausstellung mit dem Titel „The Walk – Keine Retrospektive“ verfasst. Eine Kopie dieses Textes ging zusammen mit Fragen an Bernhard Schwichtenberg. Der in Kiel lebende Bildende Künstler ist rund ein halbes Jahr älter als Gerz. Beide wurden in Berlin geboren, im Krieg evakuiert und wuchsen im Rheinland auf. Wie Gerz nahm Schwichtenberg eine Professur an. Um zu ergründen, ob die Übereinstimmung weiter reicht, trafen wir uns zu Gesprächen. Der nachfolgende Text entstand auf Basis eines einstündigen Audiomitschnitts.
Beginnen wir mit der Begriffsbestimmung. Was ist Kunst, Bernhard Schwichtenberg? In Schleswig-Holstein politisch zuständig ist ein Ministerium, das Bildung, Wissenschaft und Kultur im Titel trägt. Wäre nicht Kunst statt Kultur der korrekte Begriff? Und „kulturelle Bildung“ in der Form wie Politik sie fördert, durch ästhetische Bildung zu ersetzen?
Bernhard Schwichtenberg: In politischen Reden und Parteiprogrammen heißt es: Wir wollen die Kunst und die Kultur fördern! Kunst und Kultur, so in einem Atemzug, das zeigt, dass keiner begriffen hat, dass die Kunst zur Kultur gehört. Kultur ist der Oberbegriff, ist das Dach. Damit ist alles gemeint, was die Menschheit hervorgebracht hat. Also Wissenschaft, die Künste wie Literatur, Musik, die Darstellenden Künste, aber auch alles andere – vom Alphabet bis zur Sprache, von der Ampel bis zum Auto, vom Besteck bis zu den Tischmanieren. Alles Dinge, die der Mensch sich hat einfallen lassen in den vergangenen Jahrhunderten.
Der legendäre Kieler Oberbürgermeister Andreas Gayk schuf nach dem Krieg einen Kultursenat. Der war besetzt mit Professorinnen und Professoren verschiedener Disziplinen der Christian-Albrechts-Universität. Sie kamen im Dutzend zusammen, um den Oberbürgermeister bei den vielen Dingen zu beraten, die nach dem Krieg zu bewältigen waren. Überdies sollten sie ihm und der Ratsversammlung einmal im Jahr Persönlichkeiten für den Kulturpreis vorschlagen. Der erste, der den Kulturpreis der Landeshauptstadt Kiel bekam, war Emil Nolde – 1952. Rund vierzig Jahre darauf benannte Norbert Gansel als Oberbürgermeister die Runde in Kultur- und Wissenschaftssenat um. Fortan gab es zwei Preise, einen für Kultur und einen für Wissenschaft. Wenn man die Wissenschaften als einen wesentlichen, großen Bestandteil unserer Kultur ansieht, wie überall in Deutschland und darüber hinaus, dann ist es schon ulkig, dass Kiel hier differenziert. Der mit dem Kulturpreis, das ist die Spitzenkraft, die bekommt das Höchste, was Kiel zu vergeben hat. Darunter rangiert der Preis für Wissenschaftler? Das ist nicht einzusehen. Außerdem ist das doppelt gemoppelt.
In Adaption eines Anglizismus entstand in Deutschland der Begriff Kultur- und Kreativwirtschaft. Dahinter steckt die Idee, das kreative Potential von Künstlerinnen und Künstlern für die Wirtschaft auszuschöpfen. Dagegen entwirft Jochen Gerz die Vorstellung einer „Öffentlichen Autorschaft“. Er will Kreativität nicht auf einen exklusiven Kreis von Menschen beschränken sondern fordert mehr Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen.
Bernhard Schwichtenberg: Dazu habe ich ein kleines Stückchen von Jean Monnet mitgebracht, von einem Wirtschaftswissenschaftler Frankreichs. Er lebte von 1888 bis 1979, ist also sehr alt geworden. Im Jahr 1955 gründete er das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa und betrieb die Europäische Integration. 1975 ging die Kommission über in den Europäischen Rat. Der frühere Kulturstaatsminister Jack Lang zitiert Monnet wie folgt: „Wenn ich es noch einmal zu tun hätte, würde ich mit der Kultur beginnen“. Das Witzige an der Geschichte ist, dass im Französischen das Wort Kultur gar nicht existiert. Wenn sie es übersetzen, tun sie es mit „civilisation“. Schlägt man im Wörterbuch unter „culture“ nach, erfährt man, dass es sich dabei um etwas Gärtnerisches handelt wie die Züchtung und den Anbau von Pflanzen und so weiter.
Es ist eine schwierige Aufgabe zusammen zu tragen, was wir unter Kulturwirtschaft in Deutschland verstehen. Den meisten fallen dann so Begriffe ein wie Kulturbeutel oder alles rund um Mode. Dieser gesamte Komplex Kulturwirtschaft erwirtschaftet in der Bundesrepublik Deutschland übrigens erheblich mehr pro Jahr als alle anderen großen Industriezweige. Also zum Beispiel die Autoindustrie oder die chemische Industrie, die sonst an vorderster Stelle liegen. Mir gefällt das Zitat von der Webseite der Unesco, das Jochen Gerz in seinem Essay bringt. Anders als ich benutzt er den Begriff Kreativwirtschaft: „Die Kreativwirtschaft einschließlich audiovisueller Produkte, Design, neuer Medien, darstellender Künste, Verlagswesen und bildender Künste ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der globalen Wirtschaft. Kreativität und Kultur haben darüber hinaus einen nicht monetären Wert, der zu sozialem Fortschritt, Dialog und Einigkeit zwischen den Völkern beiträgt.“
Kreativität ist bei Gerz eine Methode, die zur Sozialisierung beiträgt. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen: creare, der Creator ist der Schöpfer. Die kreativen Leute sind diejenigen, die Ideen, Einfälle haben. Und man könnte auch die Fabulierkunst darunter subsumieren oder man könnte sagen, das sind Leute, die schöpferisches Empfinden haben oder Erfindungsfähigkeit besitzen. In allen Bereichen unserer Gesellschaft brauchen wir Menschen mit kreativen Einfällen. Das kann jemand sein, der programmieren muss, der bestimmte Problemlösungen über Programmiersprachen für den Computer entwickeln muss. Das kann in der Küche stattfinden, im Ingenieurbüro, im Wasserwerk oder auf der Rennbahn oder wo immer. In allen Branchen werden die interessantesten und einfallsreichen Leute gebraucht. Also davon sollten wir uns verabschieden, Kreativität auf irgendwelche Bereiche der Gesellschaft zu konzentrieren. Es braucht Freiräume, man muss die Menschen von der Leine lassen. Dann kommen die besten Sachen dabei heraus.
Damit sind wir beim zweiten großen Komplex unseres Gesprächs angelangt, zu der Frage: Welche Funktion hat Kunst für die Gesellschaft?
Bernhard Schwichtenberg: Auf einem von Klaus Staeck entworfenen Plakat steht: „Die Kunst ist frei“. Er brachte das Wort Kunst unter einer Glocke auf einem Käsebrett an. Damit deutet er an, dass die Kunst erheblichen Zwängen unterliegt. Und hat dabei die Bildende Kunst im Blick. Alles andere würde ja gar nicht so leicht unter eine Käseglocke passen. Oft wird unter „Kunst“ nur die Bildende Kunst verstanden. Es sind aber vielmehr „die Künste“ gemeint, also alle hochkünstlerischen Bereiche wie Literatur, Musik und so weiter.
Antworten möchte ich noch mit einer weiteren Postkarte. Darauf steht ein Zitat von Claes Oldenburg: „Ich bin für eine Kunst, die etwas anderes tut, als in einem Museum auf ihrem Arsch zu sitzen.“ Das gefällt uns ganz gut. Wir müssen uns in Bewegung setzen, uns in den öffentlichen Raum begeben. Künstlerinnen und Künstler aller Bereiche sind die Problemlöser unserer Gesellschaft. Durch ihre Studien sind sie gewohnt, fachrichtungsübergreifend zu arbeiten. Wenn sie ein Team brauchen, um ein bestimmtes Problem anzugehen, bringen sie die richtigen Leute zusammen. Das sind Menschen, die die Ohren und Augen aufsperren, sobald sie in der Gesellschaft Dinge sehen, die falsch laufen. Das geht denen richtig unter die Haut. Und ich kenne viele solcher Leute, die daran verzweifeln, wie dies politisch tapeziert wird, übertüncht wird, wir belogen werden und so weiter, bloß weil bestimmte Interessen dahinter stehen. Bestes Beispiel ist der Abgasbetrug bei Dieselmotoren. Wie kann man bei einem Verbrechen solchen Ausmaßes verharmlosend von Schummel reden?! Und die Verantwortlichen müssen erst durch Gerichte gezwungen werden, sich um den Schaden zu kümmern! Kunst muss sich einmischen. Das ist eine Verabredung, die alle Kreativen schon lange getroffen haben, einmischen in die Gesellschaft, müssen sich verbünden, und müssen aktiv etwas tun.
Als weiteres Stichwort zu diesem Komplex notierte ich mir: Kommunikation. Die Bildende Kunst ist immer auch auf den Austausch von Botschaften, auf das Hin und Zurück angelegt. Das ist die berühmte Beziehung zwischen Sender und Empfänger, die man aufbauen muss. Beide müssen dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Bildsprache, dieselbe Sprache zum Hören, denn das Ziel bei sämtlichen kreativen Bereichen ist immer die Verständigung.
Multimediale Informationen vermehren sich heute unglaublich schnell und in alle Richtungen. Für die Verständigung werden audiovisuelle Medien benötigt, deren Codes – ich habe das ja eben bereits angedeutet – beide Seiten lernen müssen. Wir wissen, dass der Mensch mehr als 80 % seiner Informationen über den Gesichtssinn, also über die Augen aufnimmt. Dazu kommt das Hören mit noch einmal 11 %. Zusammen sind wir bei weit über 90 %. Alle anderen Sinnesbereiche teilen sich den Rest. Eine Reaktion auf diesen audiovisuellen Overkill ist das wieder erwachte Interesse am Kochen. Warum sendet das Fernsehen so viele Kochshows? Das hängt damit zusammen, dass sich beim Kochen die Sinnesorgane tüchtig austoben können, sogar wenig organisierte Felder im Gehirn. Das sind so Wiederbelebungsversuche völlig ungeübter Fähigkeiten. Sonst verblöden die Menschen.
Die letzte unserer drei großen Fragen, die wir uns vorgenommen haben, lautet: Welche Eigenschaften braucht es, um die skizzierten Probleme der Gesellschaft nachhaltig zu lösen?
Bernhard Schwichtenberg: Auf beiden Seiten, beim Sender wie beim Empfänger, brauchen wir Menschen mit Charakter. Und nach Möglichkeit welche mit Humor. Und Empathie, dieser Begriff ist ja wieder im Kommen. Er bezeichnet die Fähigkeit, mit den Gehirnwindungen meines Gegenübers denken zu können, mich in die Lage des Anderen hineinzuversetzen. Wenn ich für den etwas entwerfen soll, ist es ja ganz gut, wenn ich mich in seine Lage hineinversetze, überlege, ob das funktioniert, ob das ankommt. Und dann habe ich noch notiert, es müssen Menschen sein mit einer ausgeprägt kreativen Seele. Und wir brauchen eine ästhetische Bildung von klein auf mit viel Spielraum und mit sensibler Pädagogik. Sonst wird das nie was.
Der Homo ludens, der ist gefragt. Ludere ist Lateinisch, meint das Spielen, und Homo, den Menschen. Sich mit Spieltheorie zu beschäftigen ist das Wichtigste überhaupt. Dann weiß man, was das Spiel für ein Gewicht hat, in der Erziehung, in der Pädagogik. Wir brauchen in allen Feldern der Gesellschaft Ideen. Deutschland gibt überall damit an, ein Land der Ideen zu sein. Denn wir sind nicht mehr so auf Maloche angelegt, auf körperliche schwere Arbeit. Wir arbeiten mit Patenten und verkaufen die weltweit und sind damit bisher ganz gut gefahren.
Aufgabe der Schulen und der Ausbildungsstätten ist es, die kreativen Fähigkeiten kommender Generationen nach Kräften zu fördern und nicht zu deckeln. Selbst die Kleinsten brauchen den Freiraum der Bewegung statt einer Industrie voll Spielzeugen, die ihnen alles vorkauen. Stellen Sie sich vor, Adam Riese hätte eine Ausstellung gemacht: Wir ziehen rechnend von Bild zu Bild: 2+2=4. Das wusste ich vorher schon. Oder hier muss ich 3x3=9 selber ausrechnen. In zehn Minuten bin ich durch das gesamte Haus durch, habe überall Antworten gegeben, aber kein Vergnügen daran gehabt, weil meine Fantasie nicht gefragt war. Die Aufgabe von Kunstschaffenden ist doch gerade, die Fantasie der Empfänger unserer Botschaften zu entwickeln, bzw. zu beschäftigen. Künstler stellen sich deshalb gern bei Vernissagen zu ihren Werken, um zu hören, was die Leute so schwatzen über die Arbeit, was sie empfinden. Dabei kriegt man Deutungen, an die man selber nie gedacht hat. Und so muss es doch sein, dass wir in Betrieb, auf Touren kommen. Oft ist die Kreativität leider verschüttet durch falsche Aufgabenstellung, durch Reglementierungen, aber auch, weil es vielen Pädagogen nicht gelingt, ein paar Richtungen anzugeben, ansonsten aber die Spielwiese offen zu halten.
Ästhetische Bildung von der Krippe kontinuierlich und systematisch angeboten bis zum Schulabschluss – davon ist Schleswig-Holstein weit entfernt. Durchgesetzt hat sich dagegen eine Event- und Häppchenkultur. Kurze Injektionen mit Kunst in Form eines Wochenprojektes.
Bernhard Schwichtenberg: Das ist ein glänzender Hinweis. Ich finde noch eine andere Einzäunung befremdlich: Wenn Eltern und Pädagogen den Kindern Grenzen ziehen. Bleib doch dabei. Mach das noch mal. Oder verbesser dies und das. Und dann sitzt man dran, obwohl die Arbeit schon fertig war. Für solche Zwecke habe ich eine Karte von Nam June Paik in der Tasche. Der Koreaner lehrte an der Akademie Düsseldorf. Da steht drauf: „When too perfect, liebe Gott böse“. Und das finde ich ganz gut, das heißt nämlich, die Perfektion macht jede Kreativität kaputt. Zumindest besteht die Gefahr dabei.
Wir verabredeten, exemplarisch einige Projekte zu nennen, die diese Forderung erfüllt haben, damit der Charakter solcher Arbeiten deutlich wird.
Bernhard Schwichtenberg: Zwischen 1975 bis 1985 habe ich jährlich zur Kieler Woche mit Studenten der Kieler Muthesius Hochschule Workshops für Kinder, Jugendliche und Familien angeboten. Dabei bauten wir unter anderem Windräder. Das war für alle Seiten ein Gewinn. Und 2017 habe ich rund ein halbes Jahr an sechs Schulen in Schleswig-Holstein mit integrativen Klassen gearbeitet. Dreidimensionale Aufgaben bekamen die von mir gestellt, so Pop-Up-Arbeiten. Am Ende stellten wir gemeinsam aus. In diese Reihe gehört auch ein Projekt, das inzwischen 45 Jahre läuft. Seit 1974 fertige ich weihnachtliche Drahtobjekte an, handtellergroß, also kleinteilige Dinge in einer Auflage von zehn Stück. Im November frage ich herum, was war das wichtigste Thema bisher dieses Jahr. Kriege, Waffenexporte, Hunger, Konsum, Deutsche Einheit – alle diese Fragen tauchen da auf. Immer wieder ist Flucht dabei. Dieses Thema verbinde ich mit der biblischen Weihnachtsgeschichte. Das ist mein Job. Diese Aufgabe habe ich mir selber gestellt. Und ich habe bisher noch keine Mühe gehabt, zehn Leute für die zehn Objekte zu finden. Mindestgebot ist immer 150 Euro. Manche Käufer zahlen das Doppelte dafür. Den Erlös spende ich.
Und Arbeiten anderer Künstler…?
Herausragend ist auch das Projekt von Gunter Demnig, der seit 1992 durch Europa läuft und junge Leute begeistert, sich zu beschäftigen mit den Häusern, in denen Juden gewohnt haben, bevor sie von Nazis deportiert und ermordet worden sind. Seine Messingplättchen mit den Lebensdaten dieser Menschen finden wir in 23 Ländern Europas. Insgesamt siebzigtausend Stolpersteine waren es letzten Herbst. Also, das ist ein ganz gewaltiges Projekt. Das Besondere dabei ist, dass es ihm gelang, junge Leute dafür zu begeistern, Informationen zu besorgen. Im Grunde haben sie die Ermordeten wieder lebendig werden lassen, nicht nur durch die Messingsteine, sondern vor allem durch das Gespräch im Zusammenhang mit Nachbarn und anderen.
Dann habe ich Joseph Beuys hier noch notiert mit seinem Projekt „7.000 Eichen“. Das werden viele kennen. „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ nannte er das. Damit fing er 1982 an zur documenta 7. Vor dem Museum Fridericianum türmte er tausende von Basaltsteinen auf. Für jeden sollte eine Eiche gepflanzt werden. Die erste setzte er selbst. Dann regte er andere an, ebenfalls Bäume zu stiften für Kassel, damit die Steine vom Platz kämen. Das lief vier Jahre lang bis zum 23. Januar 1986. Seine Witwe setzte den letzten Baum. Damit war das Projekt abgeschlossen. Das ist ein sehr reizvoll erweiterter Kunstbegriff, den Beuys hier verwendet hat. Im Originalton:„Als ich an ein plastisches Gestalten dachte, das nicht nur physisches Material ergreift sondern auch seelisches Material ergreifen kann, wurde ich zur Idee der sozialen Plastik regelrecht getrieben.“ Das Zitat von Beuys passt ganz gut hier rein.
Von Jochen Gerz habe ich mir herausgepickt das „Mahnmal gegen Rassismus“. Mit Studenten der damals noch sehr jungen Kunsthochschule Saarbrücken sammelte er Pflastersteine. Jeder stand für einen der jüdischen Friedhöfe, die es vor den Nazis in Deutschland gegeben hat. Am Ende waren das 2.146. In allen Großstädten, in kleineren Städten, in Orten, überall gab es kleine jüdische Friedhöfe. Sie gravierten die Steine und tauschten sie nachts auf dem Schlossplatz gegen Pflastersteine aus, jeweils mit der Schriftseite nach unten. Nach drei Jahren war die Aktion abgeschlossen. Daraufhin beschloss der Landtag diesen Platz umzubenennen. Er heißt jetzt: „Platz des unsichtbaren Mahnmals“. Darum kann man Saarbrücken nur beneiden.
Weitere Arbeiten von Jochen Gerz sowie sein oben erwähnter Essay, der unserem Diskurs als Ausgangspunkt diente, befinden sich auf seiner Webseite. Bernhard Schwichtenbergs Antworten wurden im März 2019 aufgezeichnet. Sie wurden für diesen Beitrag sehr stark gekürzt und leicht überarbeitet. Die hier veröffentlichte Fassung wurde von ihm Ende Juli 2019 freigegeben. Es ist geplant, den gesamten O-Ton im Herbst als erste Folge eines Podcasts über Kunst und Politik zu veröffentlichen.