
© Daniela Mett / 2009
Wieso eigentlich der letzte Platz im Ranking? Ich gehe seit zehn Jahren wieder zur Schule. Und mit mir ganz viele Eltern, die alles dafür tun würden, damit ihr Kind hochschulreif in der Erwachsenenwelt ankommt.
Anfangs sollte ich täglich mindestens zehn Minuten das Lesen und Schreiben üben, später Deutsch diktieren und Rechtschreibung prüfen. Das wurde mir beim ersten Elterngespräch nahegelegt. Denn das könne sie nicht bei allen Kindern unserer Integrationsklasse leisten, erklärte mir die Klassenlehrerin. Ab Klasse 2 parierte ich auf englische Wortfetzen. Wir waren die erste Kieler Grundschulklasse mit bilingualem Unterricht: “Guck mal Mama, da liegt ein Blatt oak”. Dazu kam das Kopfrechnen und pro Woche eine Kolonne Zahlen vom kleinen Einmaleins. Ich lernte mit jedem Kind das Gedicht vom Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland auswendig und ersann beim zweiten eine kindgerechte Methode, sich seine fünf Strophen effektiv anzueignen sowie der Versagensangst vor deren öffentlicher Darbietung zu begegnen.
Die Aufforderung der Schulleitung, das Nachmittagsprogramm unserer Ganztagsschule durch meine ehrenamtliche Mitarbeit zu bereichern, übersah ich gewissenhaft von Schuljahr zu Schuljahr. Denn dafür gibt es Profis, denen ich mit meinem Angebot die Lebensgrundlage entziehen würde. (Es reicht, dass wir beim Abholen der Kinder von ihrer Hausaufgabenbetreuung gelegentlich den 1-Euro-Jobbern die Aufgabenstellung der Lehrkräfte erklären mussten). Dafür habe ich mittlerweile zwei Klassenräume gestrichen, einen Sack Schulgardinen dank Elternspenden zur Wäscherei bringen können, jedes Jahr mit Schülergruppen für deren Weihnachtsbasar gebastelt und gefühlte hundert Bleche Kuchen zu Schulfeiern gestellt.
In der Orientierungsstufe angekommen, fingen sie an, sich morgens ein Kind zur öffentlichen Ranzeninspektion herauszupicken. Wir machten den Anfang. Dabei erfuhr ich, dass unsere vom ABK allen Grundschülern zur Einschulung spendierte Trinkflasche gegen ein Plastikmodell auszutauschen sei und wir zwei Hefte zu viel und ein Buch zu wenig dabei hatten. Um diesen miesen Ersteindruck nicht noch weiter zu vertiefen, erfolgte Monate lang daheim stets ein gemeinsamer Vorcheck am Abend. Per Unterschrift belegte ich zudem im Hausaufgabenheft meines Kindes, dass es daheim selbständig alle Aufgaben wunschgemäß erledigt habe. Die Schule machte Stichproben. Beim Elternabend klagte der Englischlehrer, ihm würden zunehmend Aufsätze vorgelegt, die augenscheinlich Erwachsene verfasst hätten. Um den Anschluss an dieses ehrgeizige Leistungsziel nicht völlig zu verlieren, führten wir daheim die Kategorie “Entwurf” ein. Eine Reinschrift ins Heft erfolgte erst nach dem Gegenlesen. So lernten wir nunmehr auch Englisch grammatikalisch rechtschreiben. Das wurde höchste Zeit. Alle anderen in der Klasse konnten das. Außerdem kannten sie Methoden, um für einen Test 80 Vokabeln en bloc aus dem Lehrbuch zu lernen. Zum Glück bekamen wir gleich zu Beginn parallel noch Latein mit fünf Wochenstunden. Im Prinzip ist das da ja gleich.
Bei meinem Abi vor gut dreißig Jahren wurde ich in Mathe geprüft. Das reicht, um dem aktuellen Schulstoff folgen zu können. Bei Bedarf erkläre ich die Rechenregeln fürs Auflösen von Gleichungen mit ein oder zwei Unbekannten und das Kürzen von Brüchen. Wir erfinden alternative Rechenwege, wenn die Methode des Lehrers vormittags so wenig anschaulich war und seine Zeit für Erklärungen knapp. Er ist Referendar, stürzte sich sofort nach Abgabe seiner letzten Examensklausur Vollzeit ins aktive Schulleben. Wir Eltern unterstützen ihn, wo wir können. Wäre er nicht, hätten wir keine Lehrkraft – so wie in Deutsch: Die Stunden fallen seit sechs Wochen aus oder werden durch eigenverantwortliches Arbeiten ersetzt, die EVA. Allmählich machen wir uns Sorgen um die Gesundheit unseres Lehrkörpers. Einen Schnupfen hat ja jeder mal, aber es mehren sich Fälle tiefer greifender Erkrankungen. Grundsätzlich dürften sich die Schulleiter sofort Ersatz holen. Da gäbe es eine neue Regelung vom Ministerium. Doch es fehle überall an Pädagogen, die willens und fähig sind, als Springer zu fungieren, erfahren wir auf Sitzungen des Schulelternbeirats. Der Ruf nach Hilfe verhalle im Nichts. Im Notfall teilen sich zwei Schulen eine Fachlehrkraft. Somit verteilt sich der Mangel zumindest gleichmäßig übers Stadtgebiet.
Um das Interesse am Fach während solcher Ausfallzeiten wach zu halten, füllen wir die Lücke privat. Kunsthalle und Stadtgalerie bieten gegen Gebühr Malkurse, die Stadtbücherei sogar kostenlos einen FerienLeseClub. Auf dem freien Markt gibt es gefühlt mehr Angebote als Kinder. Weshalb jeder unserer Klassenkameraden was nebenher am Laufen hat, einige schon seit der 5. Klasse; das Gängigste ist klassische Nachhilfe. Rund um unsere Schule siedelten sich Privatlehrer und Nachhilfeinstitute an. Das ist clever. Denn wenn die Kinder nach acht Stunden Unterricht aus der Schule kommen, wollen sie nicht noch weit fahren müssen.
Letzten Winter belegte ich acht Doppelstunden “Griechisch für Eltern”, die mich in die Lage versetzten sollten, Vokabeln beim Erwerb der dritten Fremdsprache abfragen zu können. In drei Jahren machen wir Abitur. Für mich wird es das zweite Mal sein. Ich habe eine Berufsausbildung, danach studiert und im Ausland Grundlagen erforscht und gelehrt. Bekäme ich hier bezahlte Arbeit, fände ich wohl keine Zeit mehr fürs zweite Abi. Bis es soweit ist, arbeite ich weiter daran, Schleswig-Holstein im Bildungs-Ranking nach vorn zu bringen. Den letzten Platz empfinde ich persönlich als Beleidigung.
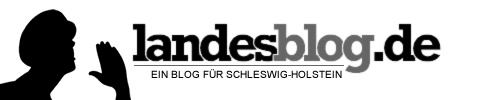
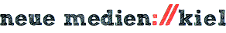

Ich wünschte, es gäbe mehr von solchen engagierten Eltern! An meiner Schule ist es oft nicht so.
Leider höre ich von engagierten Eltern oft, dass sie sich von der Schule zu wenig unterstützt fühlen und von Lehrern, dass die Eltern zu wenig unterstützen. Vielleicht gäbe es da, ganz unabhängig von der bildungspolitischen Situation, noch Verbesserungspotential. Mehr Miteinander zwischen Elternhaus und Schule und nicht ein, im besten Falle, engagiertes Nebeneinanderherarbeiten.
Das viele Probleme auch aus den von ihnen benannten ungünstigen Rahmenbedingungen herrühren, sollte meiner Meinig nach noch mehr und noch transparenter kommuniziert werden. Die Tatsache, dass mittlerweile nicht einmal mehr Vertretungslehrkräfte auf dem Markt sind, auf die man in Krankheitsfällen zurückgreifen kann, zeigt sehr deutlich eine Schieflage des Bildungssystems. Wenn dann auf unfertig ausgebildete Studenten oder Wartelistenkandidaten fürs Referendariat zurückgegriffen werden muss, die im schlimmsten Falle neben einer vollen Stelle auch eine Klassenlehrervertretung übernehmen sollen, sind weitere Probleme für SchülerInnen, Eltern und KollegInnen vorprogrammiert.
Das Vertretungslehrer fehlen ist aber nicht neu, das haben wir doch schon seit einigen Jahren hier in SH.
Das es Schulen mit 25% langzeit kranken Lehrern gibt macht mir aber noch mehr sorgen. Wir haben eine Schule gewechselt weil unsere Landesregierung das System kaputt spart und nur noch an Gymnasien ausreichend Mittel bereit gestellt werden.
„Den letzten Platz empfinde ich persönlich als Beleidigung.”
Ich finde diesen Satz ziemlich unpassend! Es gibt äußerst wahrscheinlich in jedem Bundesland Eltern wie Sie, solange man Rankings aufstellt, wird es letzte Plätze geben, das ist nun einmal so und etwas schlechtes muss es ja auch nicht bedeuten, wenn alle extrem gut sind, ist „sehr gut” eben auch der letzte Platz.
Wobei, letzter Platz? Steffen Voß hat dazu gebloggt und beste Beispiele gebracht, da relativiert sich der letzte Platz schnell wieder:
http://kaffeeringe.de/2279/traue-keiner-statistik/
Ich bin zudem auch nicht sicher, wie gut es ist, wenn Eltern sich so sehr für ihre Kinder bzgl. Hausaufgaben/Lernen einsetzen. Ich habe dies nie erlebt (na gut, 4. Klasse hat meine Mutter einmal einen Aufsatz für mich geschrieben). Es war in der Schule teilweise befremdlich mit anzusehen, wie Mitschüler im Unterricht Probleme hatten, aber immer beste Hausaufgaben. Und wie Lehrer dies leider oft nicht bemerkten und so eben diese Schüler nicht förderten, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Umgekehrt wurden Schüler wie ich mit mittelmäßigen Noten „bestraft” ob unserer teilweise mittelmäßigen Aufsätze/Rechtschreibung (und andere dann auch in Mathe). Ich fühlte mich unfair behandelt, was meinen Ehrgeiz dämpfte, da ich nicht willens war, gegen die Leistung von anderer Schüler Eltern anzukämpfen. Die wurden aber auch unfair behandelt, da sie selten richtig bewertet wurden und selten die nötige Förderung und den nötigen Druck/Ansporn/Leistungsanreiz bekamen.
Ich stehe dem also sehr zwiegespalten gegenüber. Klar, die eigenen Kinder sollen gefördert werden. Aber so weit zu gehen, dass man quasi einen 2. Abschluß macht? Vielmehr sollten Schüler angehalten werden, sich gegenseitig zu helfen, statt einige von ihren Eltern, andere von Nachhilfelehrern und wieder andere gar nicht.
Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, etwas mehr Zeit an der Schule zu verbringen und daheim gar nichts mehr für die Schule machen zu müssen oder gar dürfen.
Meine Eltern wären im Leben nicht darauf gekommen, ständig mit mir Hausaufgaben zu machen. Ich habe zwar ein schlechtes Abitur, aber das habe ich wenigstens selbst gemacht.