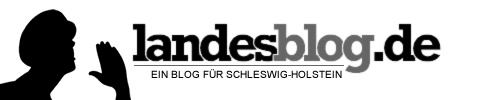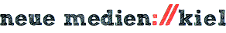Der Handel über den Atlantik soll Dank TTIP einfacher werden.| Foto: Daniel Ramirez - CC BY 2.0
Das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union – kurz: TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – ist heftig umstritten. Die Befürworter des Abkommens hoffen auf neue Arbeitsplätze, steigende Löhne und mehr Wachstum und Wohlstand. Die Gegner befürchten, dass all diese glorreichen Aussichten nur auf Kosten von Verbraucherschutz und Umweltstandards möglich sind, wenn überhaupt. Das Problem das beide Seiten in diesem Streit miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass Informationen über das, was einmal die größte Freihandelszone der Welt werden soll, nur Tröpfchenweise an die Öffentlichkeit gelangen, weil die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt finden. Dass dieser Umstand bei dem ein oder anderen für Bedenken sorgt, liegt auf der Hand. Eine Reihe von Diskussionsrunden, so genannten Bürgerdialogen, soll nun für Aufklärung sorgen. Der Startschuss für die Kampagne „TTIP – Wir müssen reden!“ fiel Anfang Oktober in Kiel.
Die Europa Union Deutschland (EUD) hatte in die Räume der Industrie und Handelskammer der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt geladen. Und dieses Gesprächsangebot wurde dankend angenommen: Zwar platzte der Saal nicht aus allen Nähten, aber nur wenige der rund 120 Sitze waren frei geblieben. Das Thema hatte Interessierte jeder Couleur und jeden Alters angelockt. Noch bevor es losging bekam jeder Besucher die Aufgabe seine aktuelle Position zum Freihandelsabkommen mithilfe eines farbigen Aufklebers auf einer „Stimmungslinie“ zu markieren. Je weiter links man seinen Aufkleber platzierte, desto kritischer stand man den Plänen von EU und USA gegenüber.
Stimmungsbild per Klebepunkte
Die große Mehrheit hatte ihren orangefarbenen Klebepunkt auf die linke Hälfte der Stimmungslinie gesetzt. Es gab Gesprächsbedarf. Als Gesprächspartner waren Vertreter der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), der EU und des Hausherren der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) anwesend. Für den volkswirtschaftlichen Hintergrund sorgte Professor Langhammer, vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Das erste Wort hatte freilich der Vertreter des Gastgebers EUD, der es sich als guter Europäer bei seiner Begrüßung nicht nehmen ließ, etwaige Schuldzuweisungen bereits im Vorfeld gleichmäßig auf alle Mitgliedsländer zu verteilen, in dem er darauf hinwies, dass Brüssel irrtümlich für Vieles verantwortlich gemacht wird, was eigentlich in den Hauptstädten entschieden wurde. So auch die Pläne für TTIP.
Bevor es nun richtig losging, wollte Moderator, Martin Lätzel, noch einmal genauer wissen, wie es um die Stimmung bei den Anwesenden bestellt war. Während er Einzelne nach den Beweggründen ihres Kommens fragte und die zu erwartenden Schlagworte Investitionsschutz und Chlorhühnchen fielen, warf er selbst einen Begriff ein, der für den Rest des Abends über der ganzen Veranstaltung zu schweben schien: German Angst. Den Menschen diese Angst zu nehmen war nun das erklärte Ziel dieses Bürgerdialogs und tatsächlich waren die kritischen Töne schon in der Vorstellungsrunde der Vertreter der geladenen Interessenverbände eher leise – und erwartungsgemäß verteilt.
Während beispielsweise, BDI und IHK von den Vorteilen fallender Zölle — auch für kleine Unternehmen — schwärmten, hieß es von Seiten der Verbraucherzentrale, man sei zwar nicht dagegen, aber skeptisch. Vom DGB hieß es, man achte darauf, das TTIP nicht zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen werde. Richtig konkret wurde es erst, als Professor Dr. Rolf J. Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft das Wort ergriff, im Bemühen die Befürchtungen der Anwesenden durch wissenschaftliche Erkenntnisse von einer emotionalen, auf eine rationale Grundlage zu stellen.
Expertise vom Institut für Weltwirtschaft
Langhammer referierte unter anderem über Umleitungseffekte, durch die globale Handelsströme im Zuge des Freihandelsabkommen so ausgerichtet würden, dass gerade ärmeren und landwirtschaftlich geprägten Staaten außerhalb der Freihandelszone Nachteile entstehen dürften. So genannte Diskriminierungseffekte, so Langhammer weiter, existieren aber bereits und ihre Auswirkungen seien bislang moderat. Angesprochen wurden auch die unterschiedlichen Perspektiven der Verhandlungspartner z.B. bei Verbraucherstandards: Während die Europäer nach dem Vorsorgeprinzip handeln und so in der Regel dafür sorgen, dass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fallen kann, handeln die Amerikaner nach dem Nachsorgeprinzip und überlegen sich so etwas erst hinterher. Das muss nicht grundsätzlich falsch sein: Denn während die eine Seite bereits im Vorfeld in Überregulierung ersticken kann, unternimmt die andere Seite erst etwas, sobald ein Problem tatsächlich existiert und man sicher sein kann, dass entsprechende Regeln tatsächlich notwendig geworden sind. Andererseits möchte man sich so etwas gerade im Fall von Lebensmitteln nicht vorstellen.
Selbstverständlich wurde auch die so genannte Investorenschutzklausel angesprochen, die den Kern einer jeden TTIP-Kritik bildet. Diese Klausel ermöglicht es ausländischen Konzernen gegen diejenigen Länder vorzugehen, in die sie ihr Geld gesteckt haben, wenn es dort Gesetzesänderung gibt, durch die ihre Investition gefährdet wird. Das klingt zunächst einmal sinnvoll und auch die Erklärung, dass ein solcher Investitionsschutz nötig sei, weil es eben kein einheitliches, internationales Wirtschaftsrecht gibt, scheint auf den ersten Blick einleuchtend. Doch problematisch wird es, wenn man sich die Schiedsgerichte anschaut, die in solchen Fällen entscheiden. So wird beispielsweise auch dort hinter verschlossenen Türen verhandelt und ein Widerspruch gegen die Entscheidung ist nicht möglich. Verhandelt wird außerdem immer über sehr viel Geld, eben die Investition des Unternehmens – und für die muss dann im Zweifelsfall der Steuerzahler des beklagten Landes aufkommen.
Der Hinweis, dass die Investitionsschutzklausel ja bereits vielfach, in bereits existierenden Freihandelsabkommen zur Anwendung kommt und damit längst gängige Praxis ist, beruhigt da nur bedingt. Es reicht ein kurzer Blick auf den bislang bekanntesten Fall: Vor dem Hintergrund des Freihandelsabkommens NAFTA zwischen Kanada, den USA und Mexiko, wurde Kanada zur Zahlung einer dreistelligen Millionensumme an den Gaskonzern Lone Pine verurteilt, weil ein Bürgerentscheid in Quebec den Fracking-Plänen der Firma einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte.
Natürlich wurde auch die Frage gestellt, wer denn eigentlich Gewinner und wer Verlierer des TTIP sein könnte. Nach Einschätzung von Professor Langhammer dürften beide Seiten einen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Freihandel ziehen, aber: die USA wohl doch etwas mehr als die EU. Als Begründung nannte Langhammer den Export von Dienstleistungen, der in der Zukunft immer mehr an Bedeutung erlangen werde, und in welchem die USA schon jetzt „sehr potent“ seien.
Am Ende stellte Langhammer fest, dass es sich bei TTIP um „eine Maßnahme zur Disziplinierung des Merkantilismus handele“, denn schließlich wollten alle exportieren. Und diejenigen die ein Problem mit TTIP hätten, hätten wohl eher ein grundsätzliches Problem mit einem marktwirtschaftlichen Mechanismus und eine anti-amerikanische Grundhaltung.
Zu guter letzt trat noch Lutz Güllner vor das Publikum. Güllner ist bei der EU-Kommission stellvertretender Referatsleiter für Kommunikation der Generaldirektion Handel. Auch er sprach noch einmal von den Vorteilen des TTIP, beschwerte sich über ein hohes Maß an Populismus in der öffentlichen Debatte und malte die Zukunft des westlichen Freihandels in so rosaroten Farben, dass sich die vermeintliche German Angst am Ende seiner Rede beinahe in einen kurzen Moment von German Begeisterung verwandelt hätte. Möglicherweise hätte er nicht seine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen sollen, dass ja vor allem die Deutschen in dieser Sache übermäßig kritisch, ja geradezu hysterisch seien.
Diskussionsrunde im großen Kreis
Abschließend begann die Diskussionsrunde im großen Kreis: Die Redebeiträge reichten von neugierigen Nachfragen, über ruhig vorgetragene Kritik bis hin zu lautstarker Empörung über die mutmaßliche Bedrohung durch ausländische Firmen, die kleinen, lokalen Betrieben schon seit Jahren an den Kragen wollten und denen das TTIP nun endgütig Tür und Tor öffne. In der öffentlichen Diskussion über das Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten mangelt es zugegebenermaßen nicht an Populismus und Gesprächsveranstaltungen wie der Bürgerdialog sind auf jeden Fall zu begrüßen. Solche Debatten sollten aber nicht dazu genutzt werden die Ängste der Menschen mit unpassenden Kunstbegriffen zu brandmarken und herunter zuspielen. Zudem sollte sich ein Vertreter der EU-Kommission gerade beim bevölkerungsreichsten und exportstärksten Land der EU nicht über die Sorgen der Menschen wundern, die sich zurecht fragen, ob es denn tatsächlich nur um die Interessen international agierender Großkonzerne geht.
Immerhin tragen die öffentliche Debatte und vielleicht ja auch der Bürgerdialog der EUD neue Früchte. Die Europäische Union ist jetzt einen Schritt auf diejenigen zugegangen, die vor allem die Undurchsichtigkeit des Verfahrens kritisieren. Inzwischen hat Brüssel das bislang geheim gehaltene Verhandlungsmandat für TTIP veröffentlicht. Das 18-seitige Dokument zu dem geplanten Abkommen wurde nur wenige Tage nach dem ersten TTIP-Bürgerdialog in Kiel vom Rat der EU-Mitgliedstaaten offiziell publik gemacht.
Den nächsten Bürgerdialog zum nach wie vor umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP veranstaltet die Europa Union Deutschland am 15. Dezember in Nürnberg.
Links
- Homepage: ttip-buergerdialoge.de