
By: Images Money - CC BY 2.0
36 Millionen Euro jährlich. Dieses Summe will die Landesregierung in die Schulen investieren — zum Ärger der unterfinanzierten Hochschulen. Vor der letzten Haushaltsdebatte im Landtag wird die Diskussion noch mal richtig heiß. Melanie Richter und Gunnar Maus stimmen im Landesblog in die Rufe nach mehr Geld ein.
Hintergrund
36 Millionen Euro stehen Schleswig-Holstein ab 2015 zur Verfügung, weil der Bund das Land um diese Summe beim Anteil an den Kosten für die Ausbildungsförderung entlastet. Während Berlin in Zukunft also die Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende nach dem BAföG — dem Bundesausbildungsförderungsgesetz — komplett übernimmt, kann Kiel damit andere Aufgaben in der Bildung finanzieren. Die Landesregierung möchte dieses Geld komplett in die Schulen stecken. Doch die Auseinandersetzung um die Millionen wird zum Jahresende noch Mal richtig heiß. Vor Abschluss der Haushaltsberatungen im Landtag zum Ende der Woche wird der Verteilungskampf öffentlich ausgetragen. Vor allem an der Uni Kiel, die sich als größte Hochschule im Land eine deutliche Erhöhung ihres Grundetats erhofft hat, ist die Enttäuschung groß. Uni-Präsidium und Studierendenausschuss haben für Donnerstag zu einer Demo am Landeshaus aufgerufen.
Die Hochschulen brauchen dringend mehr Geld
findet Gunnar Maus, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kiel.
„Der Forschung, der Lehre, der Bildung.” Das Motto der Uni Hamburg macht klar, worum es hier geht. Die Universitäten und Fachhochschulen sind Eckpfeiler der Bildungsrepublik. In Schleswig-Holstein haben verschiedene Landesregierungen jedoch über Jahre die Studierenden auf den Stufen sitzen, die Gebäude der Hochschulen verfallen und das wissenschaftliche Personal im Regen stehen lassen. Und jetzt gönnt die Küstenkoalition den Unis und FHs keinen Cent von 36 Millionen Euro jährlich?
Dabei ließe sich mit dem Geld viel erreichen. Während der Hochschulpakt die schlimmste Not der steigenden Studierendenzahlen abmindert, bringt er keine strukturellen Verbesserungen mit sich. Auch wenn die Studierendenzahlen irgendwann wieder sinken werden — was ist gegen bessere Studienbedingungen und bessere Ausbildung von Studierenden eigentlich einzuwenden? Und wenn eine Universität wie Kiel bereits jetzt — vor dem doppelten Abiturjahrgang — brüllend jenseits der Belastungsgrenze läuft, dann fragt man sich doch, warum sie nicht für die Größenordnung ausfinanziert wird, die sie schon längst erreicht hat. Dass Sondervermögen für die Sanierung der Gebäude und Hochschulpakte für die Sicherstellung der Lehre überhaupt nötig sind zeigt nur zu deutlich, wie sehr bisher an der Grundfinanzierung gespart wurde.
Leidtragende sind neben den Studierenden auch die Dozentinnen und Dozenten, die als wissenschaftliche Mitarbeiter in der Mehrzahl nur befristet angestellt werden. Niemand verbietet es den Hochschulen, dem eigenen Personal unbefristete Verträge wie jedem anderen Lehrer auch anzubieten — allein es fehlt das Geld. So werden immer neue Akademiker mit Zeitverträgen als „Lehrkraft für besondere Aufgaben” mit erhöhter Lehrverpflichtung verschlissen und schmeißen schon nach ein paar Jahren ausgebrannt wieder hin — wenn sie nicht schon die gesetzlich festgelegte Befristungsgrenze erreicht haben. Das Paradoxe dabei: Oft haben diese Lehrkräfte selbst kaum Zeit, hochschuldidaktische Fortbildungen zu besuchen, bilden aber unter anderem unsere Lehrerinnen und Lehrer für die Schulen aus. In der Bildungspolitik hängt eben Vieles zusammen. Und ohne qualifizierte und motivierte Lehrende an Hochschulen droht Qualitätsverlust. Eine erhöhte Grundfinanzierung würde es den Hochschulen endlich auch ermöglichen, Personalentwicklung in eigener Sache zu betreiben. Das kommt letztlich auch den Schulen zu Gute.
Die 36 Millionen gehören an die Hochschulen verteilt, denn hier wurde schon viel zu lange gespart.
Die Schulen haben das Geld nötiger
findet Melanie Richter, Gemeinschaftsschullehrerin in Kiel.
In Schleswig-Holstein sind sechs Prozent Unterrichtsausfall vorprogrammiert, auch wenn kein Lehrer krank ist. Das liegt daran, dass durch die Stundenzuweisungen an die Schulen grundsätzlich nur 94 Prozent der Unterrichtsstunden, die laut einem schulrechtlichen Erlass an den verschiedenen Schulformen unterrichtet werden sollen, tatsächlich bei den Schülern ankommen. Laut dem Gesundheitsreport 2014, den der BKK-Dachverband kürzlich veröffentlicht hat, sind die pflichtversicherten Durchschnittsarbeitnehmer etwas über 17 Tage im Jahr krankgeschrieben. Wenn man davon ausgeht, dass die Quote bei Lehrkräften ähnlich hoch liegt, muss man von etwa 3 Wochen im Jahr ausgehen, die ein Lehrer nicht da ist. Für diese Zeit gibt es für die Schule keine Vertretung, diese muss aus den Lehrerstunden bestückt werden, die noch nicht einmal zu 100 Prozent gedeckt sind. Für langfristigere Erkrankungen erhält die Schule 50 Prozent temporären Ersatz, wenn denn passender auf dem Bewerbungsmarkt zu finden ist. In Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg liegt die Unterrichtsversorgung aufsteigend bei bis zu 109 Prozent. Schleswig-Holstein gibt bundesweit das wenigste Geld für seine Schüler aus. Pro Schüler sind es 5200 Euro. Im Vergleich liegt der Spitzenreiter Thüringen bei 7800 Euro pro Schüler.
Für das Gelingen der Inklusion, bei der Schleswig-Holstein quantitativ im bundesweiten Vergleich weit vorn liegt, werden laut GEW-Berechnungen 1000 zusätzliche Lehrerstellen gebraucht, um auch qualitativ vorn zu liegen. Doch diese sind laut Schulministerium nicht finanzierbar. Lieber wird in Kauf genommen, dass zwar die Herausforderungen an den Schulen steigen, indem die Klassen immer heterogener werden, jedoch die sie unterrichtende Lehrerschaft nicht. Regelschullehrern fehlen die pädagogischen Handwerkszeuge, um Schülern mit besonderen Förderbedarfen gerecht zu werden. Sonderschullehrkräfte sind rar auf dem Bewerbungsmarkt und die Stundenzuweisungen sind nicht ausreichend, um adäquat zu fördern und dabei selbst gesund zu bleiben.
Schleswig-Holstein macht ein Minusgeschäft, wenn an der Flensburger und Kieler Universität Lehrer den ersten Ausbildungsabschnitt absolvieren, an Schulen in Schleswig-Holstein dann im Vorbereitungsdienst ausgebildet werden und danach nach Niedersachsen oder Hamburg abwandern, weil ihnen dort unbefristete Stellen angeboten werden, die es in Schleswig-Holstein zu wenig gibt. So kommt es vor allem in den südlicheren Kreisen dazu, dass zwar noch Gelder aus dem Vertretungsfond vorhanden ist, aber der Bewerbermarkt absolut leer gefegt ist, sodass es für Schulen schwierig wird, temporäre Vertretungen einzustellen, von fachlich passenden Lehrkräften ganz zu schweigen. Es wäre sicherlich mittelfristig lohnender, nicht nur in die Lehrerausbildung zu investieren, um dann gut ausgebildete Fachlehrer an andere Bundesländer zu verlieren, die mehr Geld für ihre Bildungspolitik an den Schulen ausgeben.
Die 36 Millionen gehören an die Schulen verteilt, da die Defizite zu Lasten der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Familien und der Gesundheit der Lehrkräfte gehen.
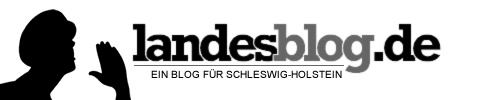
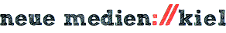

Pingback: Uni ohne Geld mit 2500 Studierenden auf der Straße | Uni ohne Geld