
Seminarraum der Nordsee Akademie / Heimvolkshochschule Leck. Foto: Nordsee Akademie.
Mit einer Finanzspritze aus ihrem Kulturetat hat Schleswig-Holsteins Ministerin Anke Spoorendonk heute den ersten Kulturknotenpunkt fit gemacht zur Übernahme der kulturellen Vernetzungsarbeit im Land. Ausgewählt wurde die Nordsee-Akademie / Heimvolkshochschule Leck unter Leitung von Oke Sibbersen. Als Ansprechpartnerin für Kulturschaffende nannte er Dr. Herle Forbrich.
Die Kulturwissenschaftlerin und promovierte Historikerin leitet Kurse und gibt Seminare an den drei Bildungsstätten des Deutschen Grenzvereins — am Scheersberg, der Akademie Sankelmark und Nordsee Akademie.
Wie das landesblog im Oktober letzten Jahres berichtete, werden nach und nach in allen Regionen Schleswig-Holsteins sogenannte Kulturknotenpunkte eingerichtet, die den vielen Kultureinrichtungen im ländlichen Raum Unterstützung anbieten sollen bei ihrem Kulturschaffen. Ihr Aufgabenspektrum umfasst die professionelle Beratung, Förderung von Kooperationen, Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit sowie das Knüpfen von Kontakten zu den Kulturzentren des Landes.
Ausgeschrieben wurden zuerst die Regionen Nordfriesland/Nordschleswig sowie Dithmarschen/Steinburg. Das Rennen machten im Januar jeweils Mitgliedseinrichtungen des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins. So darf sich nach der Nordsee Akademie demnächst ein Bewerbungskonsortium aus dem Verein für Volkshochschulen in Dithmarschen und der Volkshochschule Brunsbüttel über einen Besuch der Ministerin freuen.
Daran, dass breit aufgestellte, staatlich geförderte Einrichtungen bei der Ausschreibung Pate gestanden hatte, bestand von Anfang an kein Zweifel. Voraussetzung für die Teilnahme an der Bewerbung als Kulturknotenpunkt waren neben der wirtschaftlich stabilen Geschäftslage eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle. Auf Nachfrage bestätigten uns zwei in Nordfrieslands Szene gut vernetzte Kulturakteure, alle Vertreter der ihnen bekannnten Kultureinrichtungen schätzten den Aufwand für zu hoch und die zur Verfügung gestellte Summe für zu gering ein. Keiner sah sich in der Lage, den Job zusätzlich zur ohnehin hohen Arbeitsbelastung auf sich zu nehmen.
Dass nun mit den zwei VHS-Mitgliedern ausgerechnet Bildungs- und keine Kultureinrichtungen für die nächsten fünf Jahre zu Landeskulturknoten gekürt werden, läßt Künstlerinnen wie Künstler, aber auch Kulturmanager an der Politik zweifeln. In einem Kommentar zur Pressemeldung auf Kultur-Port macht Mitbewerber K9 Koordination für regionale Kultur stellvertretend für andere seinen Frust öffentlich:
„(…) sollte die im KulturDialog des Landes den Kulturschaffenden zugedachte und knapp bemessene Ressource jetzt tatsächlich verbraucht werden durch eine Fördermaßnahme für Bildungseinrichtungen — aufgeteilt zwischen dem Verein der Volkshochschulen für die Koordination und der VHS Brunsbüttel für das operative Geschäft. Ist das die gewünschte Innovation für die Kultur im ländlichen Raum?”
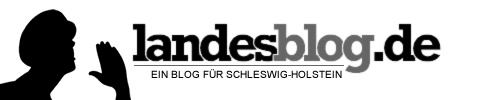
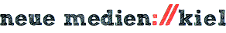

Können Volkshochschulen Kultur?
Volkshochschulen können Bildung. Dafür sind sie erdacht — und wenigstens in den vorliegenden Fällen der jetzt begünstigten Kulturknotenpunkte in Nordfriesland/Nordschleswig und Dithmarschen erfüllen die Volkshochschulen diesen Auftrag auf wirklich respektablem Niveau. Aber können Volkshochschulen auch Kultur? Kultur aus dem Geist und Anspruch der Kulturschaffenden in der Region? Ministerin Spoorendonk scheint dies zu glauben, sonst hätte sie nicht beide Kulturknotenpunkte vergeben an Mitgliedseinrichtungen des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holstein. Bewährte Kulturschaffende und Kulturnetzwerker unter den Bewerbern der Kreise Dithmarschen, Steinburg, Nordfriesland und Nordschleswig blieben unberücksichtigt.
Ist das die gewünschte Innovation für die Kultur im ländlichen Raum? Volkshochschulen sollen fortan die Interessen der Kreativen bündeln und vermarkten und sich als Motor der kulturellen Entwicklung in der Region etablieren? Hier sind Bedenken und Sorge angebracht, führt doch dieser Weg an den Erwartungen zahlreicher Kulturschaffender, Kulturvereine und -Institutionen in der Region vorbei. Leider ist dies die nüchterne Entzauberung eines vom Landesministerium proklamierten Fortschritts für die Kultur im ländlichen Raum. Kritisch zudem, sollte die im KulturDialog des Landes den Kulturschaffenden zugedachte und knapp bemessene Ressource jetzt tatsächlich verbraucht werden durch eine Fördermaßnahme für Bildungseinrichtungen — wie in Dithmarschen aufgeteilt zwischen dem Verein der Volkshochschulen für die Koordination und der VHS Brunsbüttel für das operative Geschäft.
Allein didaktisches Geschick der für die Volksbildung gegründeten Institute im Querschnitt des lebenslangen Lernens qualifiziert diese nicht als erste Wahl für die Kultur in unserem Land — auch nicht „nur” für den ländlichen Raum. Dann könnten wir künftig die Volkshochschulen auch für religiöse Aufgaben als Kirchen betrachten oder für die Lösung wirtschaftlicher Kernprobleme auch zur Beratung der Landesregierung in Anspruch nehmen.
Mir ist beim kulturpolitischen Abend im Landhaus damals klar geworden, dass nicht Institutionen sondern Menschen mit Visionen das kulturelle Leben einer Stadt, einer Region beleben. Alle drei Praxisbeispiele gingen auf Initiatoren zurück, die mit Leidenschaft bei der Sache waren. Sie konnten andere für ihre Idee begeistern und so Vieles auf unkonventionellen Wegen in Gang setzen für deren Umsetzung. Sie besaßen einen Draht zum Publikum ebenso wie zu Künstlern. Schon möglich, dass wir solche Menschen auch in Bildungsstätten finden.
Demnach hielt ich später auch die Auswahlkriterien für falsch gesetzt. Es ist sicher von Vorteil, wenn eine funktionierende Infrastruktur vorhanden ist, aber ich halte das nicht für ausschlaggebend. Sondern kommunikative Kompetenzen des Bewerbers. Vielleicht hätte man sich besser einige Wochen in der Region umhören sollen, wem die Leute solch´ einen Job zutrauen. Aber: Vielleicht bringt Frau Dr. Forbrich das alles mit? Ich kenne sie nicht! In den Interveiws, die ich zu diesem Thema letztes Jahr führte, fiel ihr Name nicht.
Kommunikative Kompetenz ist in der Tat von Vorteil gerade in dem hier beschriebenen Umfeld. Und ich bin sicher, dass auch Frau Dr. Forbrich hierüber verfügt. Es darf bei allem, was im Vorwege und jetzt bei Verkündung der Entscheidung zu den Kulturknotenpunkten gesagt wird, nicht etwa um eine Verunglimpfung der künftig für die neue Aufgabe eingesetzten Akteure gehen. Sie können für die hier angewandten Auswahlkriterien der Politik wirklich nichts. Dennoch fühlt sich ein Großteil der Kulturschaffenden nicht gut aufgehoben bei den Volkshochschulen, sieht deren gesellschaftlichen Aufgaben an ganz anderer Stelle und möchte sich auch nicht im Portfolio unter „Kultur+Gestalten” wiederfinden. Im übrigen ist eine solche Einordnung der Kulturschaffenden nicht in Einklang zu bringen mit der Aufbruchstimmung, in der zuletzt beim Abschlussplenum im Kieler Landeshaus der KulturDialog diskutiert wurde. Es hätte ein großer Wurf für die Kultur im ländlichen Raum werden können. Heraus kam die Ernüchterung kultur- und bildungspolitischer Anpassungen. Ein für die regionale Kultur und deren Kreativkräfte gedachter neuer Förderansatz wird als Zuschussprogramm für Volkshochschulen instrumentalisiert. So geht Politik.
Die schon früh prognostizierte und jetzt in die Tat umgesetzte Vergabepraxis zuungunsten der sich in beiden Regionen beworbenen Kulturschaffenden und Netzwerker ist als Politikum zu werten und liest sich fast schon wie aus dem Werkbuch zum Projekt „VHS 2020” zur „beteiligungsorientierten Strategie- und Strukturentwicklung der schleswig-holsteinischen Volkshochschulen” (ja, das gibt es wirklich). Den Volkshochschulen geht es nämlich nicht überall gut. Die drohende Insolvenz in der Kreisstadt Itzehoe konnte gerade noch abgewendet werden. In diesem Licht erscheinen Zusatzeinnahmen aus der Kulturförderung durchaus gelegen, ist doch zudem eine gewisse (auch biografische) Nähe der Entscheider in Kiel zum Landesverband der Volkshochschulen nicht zu übersehen. Dagegen kann dann auch die kommunikative Kompetenz der Kreativkräften in der Region nichts mehr ausrichten.
Bereits beim Schreiben des Artikels erinnerte ich mich daran, in der Zeitung über stufenweise Kürzungen der institutionellen Förderung bei den Bildungsstäten des Deutschen Grenzvereins gelesen zu haben. Ich fand einen der zuletzt gelesenen Berichte wieder: http://www.shz.de/lokales/nordfriesland-tageblatt/resolution-fuer-die-nordsee-akademie-id6469826.html.
Nach den mageren Jahren erwartet der Deutsche Grenzverein erstmals zusätzliche Mittel. Darüber freute sich beim Jahresempfang Jörg Dietrich Kamischke, dessen Vorsitzender: http://www.shz.de/lokales/nordfriesland-tageblatt/resolution-fuer-die-nordsee-akademie-id6469826.html.
Es gab Veränderungen bei der Zusammensetzung und Aufgabenverteilung in der Kulturabteilung des Ministerium. Dadurch hat sich der Führungsstil verändert. Auch der Kreis externer Beraterinnen und Berater. Ob sich das positiv auf die kreative Szene im Land auswirkt, bleibt abzuwarten.
Zusätzliche Mittel für die Kultur können nur von außen kommen. Die Zusammenarbeit mit der Mercator-Stiftung aus Essen steht noch am Anfang. Mit den Dänen gibt es schon länger Kulturabkommen, wovon Kreative im Grenzgebiet profitieren. Und EU-Mittel aus dem Ostseeanrainer-Aufbauprogramm könnten demnächst über die Bildungsstätten in die Region fließen, allen voran das Nordkolleg Rendsburg. Deshalb wäre es sinnvoll, die am Leben zu halten bis die Sache reif ist.
Welche „Sache” soll „reif” werden? Verstehe auch nicht, aus welchem (Ostseeanrainer?)Programm Mittel über das Nordkolleg Rendsburg in die Region fließen soll. Wissen die das? Es gibt europaweit Interreg-Programme, die politisch wie auch von Aktionsbündnissen aller gesellschaftlichen Interessengruppen beantragt werden können, sofern der grenzübergreifende Aspekt und die Rahmenbedingungen erfüllt sind. Da kommt den Bildungseinrichtungen keine herausragende Rolle zu.
Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht an dieser Stelle anlässlich der aktuellen Knotenvergabe um die Wahrnehmung und Förderung von Kultur im ländlichen Raum und deren Bedeutung für die Regionalentwicklung … und um die politische Kultur im Umgang mit der Kreativszene.
Selbstredend sollen Volkshochschulen rege teilnehmen am öffentlichen Leben — sich einbringen da, wo sie Kompetenz aufbringen für die Bildung. Deshalb ja auch die Ursprungsfrage, ob die denn Kultur wirklich können oder nur wollen.
Kulturschaffende mit ihren Netzwerkern hingegen können das. Diese „Sache” ist wirklich „reif”, darauf brauchen wir nicht zu warten. Allerdings warten wir jetzt auf die anstehende und überaus spannende Entscheidung, wer den Kulturknotenpunkt im Herzogtum Lauenburg ausfüllen darf. Da soll es nämlich im März losgehen.
Ich zitiere aus den im Dezember veröffentlichten „Kulturperspektiven” :
„Zu den Kernen kultureller Infrastruktur zählen für uns Bibliotheken, Museen, Archive, Theater und kulturelle Bildungseinrichtungen (Volkshochschulen, Akademien und Musikschulen) sowie soziokulturelle Zentren.” (25)
„Um eine flächendeckende kulturelle Infrastruktur zu fördern, sollen regionale „kulturelle Knotenpunkte“ unter Einbeziehung vorhandener Kultur- und Bildungseinrichtungen gebildet werden. Deren Aufgabe ist insbesondere die Förderung von Kooperation und Vernetzung auf regionaler Ebene.” (32)
„Wir veranstalten eine regelmäßige Kulturkonferenz des Landes mit Akteuren und Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Knotenpunkte, Verbände und Organisationen, die über kulturpolitische Entwicklungen berät. Besonders die Vernetzung mit anderen Bereichen wie Wissenschaft, Bildung, Soziales und Wirtschaft werden bei diesen Konferenzen berücksichtigt.” (35)
Das Nordkolleg Rendsburg ist zugleich Sitz des Sekretariats der Ostsee-Kulturinitiative Ars Baltica, mit Guido Froese als Vorsitzenden. Das Projekt One Baltic Sea Region lief 2013 aus. Im Aktionsplan für die Folgejahre spielen Kultur und regionale Identität eine große Rolle.
Ich habe beides zusammen gedacht, weil unsere Kultur- und Europaministerin seit 2012 davon spricht, eine langfristige Strategie entwickeln zu wollen — ich meine, 2025 hatte sie dabei avisiert. Es geht ihr, meiner Ansicht nach, nicht die einzelne Region. Dafür wären die Kommunen zuständig. Sondern um das gesamte Bundesland und dessen Zukunft. „Darüber hinaus müssen wir die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Dänemark, dem Ostseeraum und mit der Metropolregion Hamburg verstärkt überprüfen.” (33).
1. Ich durfte während des Kulturdialogs eine von vier Arbeitsgruppen leiten. „Meine” Gruppe führte den Titel „Kulturstandort Schleswig-Holstein stärken, Kulturtourismus und Kreativwirtschaft fördern“ und befasste sich u.a. mit der Problematik des demografischen Wandels und des Erhaltens kultureller Infrastruktur im ländlichen Raum. Denn um den Kulturstandort zu stärken, müssen grundlegende Kulturangebote zunächst einmal erhalten werden. In unserer Arbeitsgruppe entstand daher die Idee der kulturellen Knotenpunkte, die für die Kulturanbieter, darunter Musikschulen, Büchereien, Museen, VHSen u.a. als eine Art Dienstleister vernetzende und übergeordnete Aufgaben übernehmen sollten, regionale Interessen wahrnehmen und als Ansprechpartner für dezentrale Angebote zentraler Organisationen (TASH u.ä.) dienen sollten. Der Aufgabenkatalog ist später verfeinert worden.
Die gewünschten und benötigten Kernkompetenzen, die sich daraus ableiten, sind relativ klar. Dazu gehört sicher nicht in erster Linie, dass man „Kultur kann” — aber sicher schadet es auch nicht.
2. Ja, den Bildungsstätten sind in den letzten Jahren die Fördermittel des Landes empfindlich gekürzt worden. Dies hat in einzelnen Fällen diese Einrichtungen an den Rand der Handlungsfähigkeit gebracht. Gleichzeitig haben aber immer mehr Menschen Angebote der Bildungsstätten genutzt, ohne dass dies die Kürzungen allerdings kompensieren kann. Unter dem Strich haben alle Bildungsstätten sehr hohe Eigenwirtschaftsquoten, z.T. bis zu 80%. Dies ist gemessen an anderen Kultureinrichtungen oder auch im bundesweiten Vergleich besonders hoch. Für das laufende Jahr hat es erstmals seit über 10 Jahren eine Erhöhung der Zuwendung gegeben. Diese hat die Kürzungen aus der letzten Legislaturperiode kompensiert und auch einen Teil der (Lohn-)Kostensteigerungen der vergangenen Jahre. Dafür braucht es institutionelle Zuwendungen. Die hier und dort zu beantragenden Projektfördermittel sind dagegen kein Mittel für eine Finanzierung grundständiger Aufgaben, sondern für Sonderaufgaben in kulturpolitischen Themenfeldern. Die Verwendung von Projektfördermitteln ist detailliert und sachbezogen nachzuweisen. Die oben vermutete „Instrumentalisierung der Mittel für die Kulturknotenpunkte als Zuschussmaßnahme für Bildungsstätten oder Volkshochschulen” kann es schon aus diesem Grund nicht geben.
3. Ja, Mittel müssen zunehmend auch von außen kommen. Die Mercator-Mittel sind Folge des „Jahres der kulturellen Bildung”. (Diese Idee hat Kulturministerin Anke Spoorendonk übrigens anlässlich einer Tagung in einer Bildungsstätte entwickelt). Und ja, das Nordkolleg hat bei der Implementierung einer „Priorität Kultur” in der EU-Ostseestrategie eine wichtige Rolle gespielt. Als Träger des Ostsee-Kulturnetzwerkes ARS BALTICA und als deutscher Vertreter im koordinierenden Gremium der Ostseeanrainer sind wir vor ein paar Jahren gemeinsam mit Vertretern der SH-Europaabteilung in Brüssel gewesen und haben hierzu erste Gespräche geführt. Das war ein sehr dickes Brett, welches wir da gebohrt haben, mit vielen Gesprächen und Papieren. Mittlerweile ist die Priorität Fakt und wird von Schleswig-Holstein gemeinsam mit Polen koordiniert. Einige Projekte sind seitdem in den Genuss von Seed Money und Förderungen gekommen. Hierzu berät gerne unser Leiter des ARS BALTICA-Sekretariates.
4. Zur Beantwortung der Frage, welche Rolle Bildungsstätten noch auf lokaler, regionaler, überregionaler, landesweiter, grenzüberschreitender und internationaler Ebene im Kulturbereich spielen können, lade ich gerne ins Nordkolleg ein — eine Einrichtung, die schon seit vielen Jahren als Kulturknotenpunkt tätig ist.