
Reichstagsgebäude, Berlin | Foto: Some rights reserved by JoshLawton
Es gibt die verbreitete Meinung, dass im Parlament nicht mit offenen Karten gespielt würde, wenn das Parlament leer, das Ergebnis aber trotzdem voraussehbar ist. Wir hatten die Diskussion darüber beim Thema „Pairing” und wir haben es jetzt wieder bei der Kritik am „Meldegesetz”. Sie beruht auf dem Irrglauben, dass im Parlament diskutiert würde. Das passiert da nicht. Im Parlament finden Debatten statt. Und Debatten folgen bestimmten Regeln. Gesetzgebung ist als kommunikatives System das Gegenstück zur Rechtsprechung.
Anders als man meint, wenn man „Gerichtsshows” sieht, sind die Abläufe vor Gericht klar festgelegt: Erst spricht der Eine. Dann darf der Andere sprechen. Wenn nach diesem System alle Argumente ausgetauscht sind, entscheidet der Mensch vorne in der Mitte. Und das tut der nicht nach Gefühl, sondern auch der muss wieder auf Basis der Gesetze begründen, wie er zu seiner Entscheidung kommt. Und wenn er das nicht gut genug tut, geht man zum nächst höheren Gericht und versucht das dort noch einmal.
Rechtsprechung ist ein festes kommunikatives System. Und es ist auch im Prinzip egal wer Staatsanwältin, Anwalt, Richterin ist. Die Personen agieren in bestimmten Funktionen in diesem System — deswegen ziehen die sich in dieser Funktion auch spezielle Kleidung an. Juristen mögen mir die Vereinfachung verzeihen.
Die Grundlage der Rechtsprechung sind die Gesetze. Und die sind durch ein genauso geregeltes System entstanden. Dieses System sorgt dafür, dass aus 80 Millionen Meinungen, Interessen und Werten in Deutschland eine allgemein verbindliche Regel — ein Gesetz wird. Als Grundlage haben wir also die Meinungsfreiheit. Darauf baut die Willensbildung auf. Und das Ergebnis ist dann ein Gesetz. Politikwissenschaftlerinnen mögen mir die Vereinfachung verzeihen
Willensbildung
Die Willensbildung beginnt dort, wo sich Menschen zusammentun, um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Im Grundgesetz steht zum Beispiel im Artikel 21(1). „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. […]”. Das passiert aber natürlich auch in Vereinen und Verbänden. Dort stimmen die Mitglieder miteinander ab, was sie im Hinblick auf bestimmte Fragen vertreten. Ob Vereinssitzung oder Bundestag, ob evangelische Kirche oder Arbeiterwohlfahrt: Alle diese Sitzungen laufen nach dem gleichen Muster ab: Es ist zum Beispiel geregelt,
- dass die Mitglieder rechtzeitig von der Sitzung erfahren,
- dass sie Sitzung eine Versammlungsleitung hat, die die Sitzung eröffnet und schließt.
- Die Sitzung hat eine Tagesordnung und es ist geregelt, wer wann zu welchem Thema sprechen darf.
- In einem Protokoll werden die Ergebnisse festgehalten, über die nach einer Diskussion abgestimmt wurde.
Parteien erstellen auf diese Weise ihre Wahlprogramme. Wählerinnen und Wähler entscheiden dann, ob sie diese Programme gut finden, und ob sie den kandidierenden Personen zutrauen, die eigenen Interessen auch in Koalitionen und bei aktuellen Themen ordentlich zu vertreten. Die Wahlprogramme sind keine Fünfjahrespläne, die stur abgearbeitet werden. Gerade die „Doppelwende” beim Atomausstieg zeigt, dass natürlich Politik auf das reagieren kann, was sie als Mehrheitsmeinung wahrnimmt. Dafür hat sie das „Mandat”.
Wahlen
Auch die Wahlen laufen dann nach einem festen Prozedere ab: Wählerinnen und Wähler werden rechtzeitig zur Wahl „eingeladen”. Von 8 – 18 Uhr findet dann die Wahl statt und jeder darf seine Stimme einmal abgeben. Das Wahlergebnis wird protokolliert.
Aus den abgegebenen Stimmen wird dann errechnet, wie das Parlament zusammengesetzt ist, wessen Programm und Personal also welchen Anteil der Bevölkerung repräsentiert. In der Wahl werden dann aus 80 Millionen nur noch Meinungen fünf bis sechs Meinungen.
Regierung…
Dann gucken sich alle im Parlament um und schauen, wer mit wem am besten zusammenarbeiten kann — also wo die Ziele am ähnlichsten sind. Denn als nächstes müssen die Spitzen der Exekutive gewählt werden. Und dann ist es praktisch, wenn man sich gleich so zusammentut, dass man sich auf die Dinge einigt, in denen man prinzipiell einer Meinung ist und das Vorgehen in Fragen klärt, in denen man sich nicht einig ist. Das wird dann im Koalitionsvertrag festgeschrieben.
Die Regierung repräsentiert so zumindest tendenziell die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die Wahl ist natürlich immer eine Abstimmung über sehr viele Themen. Es ist zur Zeit die einzige Willensbekundung des Souveräns, die wir auf Bundesebene haben. Und als Abstimmung mit der üblicherweise höchsten Wahlbeteiligung hat sie auch die höchste Legitimierung.
…und Parlament
Wie ich schon in dem Artikel über das Pairing schrieb, darf diese Legitimierung nicht durch zufällige Krankheiten oder konkurrierende Ausschusstermine in Frage gestellt werden.
Es ist gut, dass in Ausschüssen die Fachpolitiker die konkrete Ausgestaltung der Gesetze diskutieren. Es gehört dann aber auch zu diesem kommunikativen System, dass dann im Parlament noch einmal alle Argumente ausgetauscht werden und auch die großen Linien der verschiedenen Parteien noch einmal aufgezeigt werden — deswegen wird im Parlament auch nie „über die Formulierung in Absatz 2 von Paragraf 17a” gesprochen. Da ist es dann auch egal, ob die Reden tatsächlich gehalten oder nur zu Protokoll gegeben werden. Doch das Abstimmungsverhalten steht als Ergebnis dieses langen Willensbildungsprozesses fest.
Dadurch ist das Parlament keine „Schaukampfbühne”, sondern ein Gesprächsrahmen, der wenig mit der Art und Weise zu tun hat, in der sich Menschen normalerweise über ein Thema unterhalten. Es ist der formale Abschluss des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens. Das wirkt künstlich, unmenschlich und intransparent — wenn man die Regeln nicht versteht.
Der Fußballvergleich zum Abschluss
Auch Fußball ergibt erst Sinn, wenn man die Regeln kennt. Ansonsten muss man sich doch wundern, warum die Leute den Ball nicht in de Hand nehmen und ihre Gegner umholzen. Warum sind da nur elf Leute in jedem Team? Und warum zwei Teams? Und auch bei Fußball ist geregelt, dass derjenige gewonnen hat, der es in 90 Minuten am häufigsten geschafft hat, den einzigen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Fußballfans mögen mir die Vereinfachung verzeihen
Links
- Süddeutsche Zeitung: Posse um Meldegesetz — So schauen Sie dem Gesetzgeber auf die Finger
Foto: Some rights reserved by JoshLawton
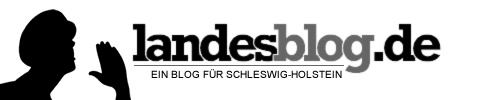
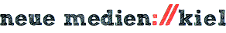

Vielleicht eine zutreffende Beschreibung des Ist-Zustandes. Allerdings bezweifle ich zum einen das Funktionieren der Repräsentanz eines Wählerwillens. Zum anderen ist es so, dass der Wähler ja Parteien und Abgeordnete wählt — und das entscheidende Gremium, die entscheidende Bühne sollte das Parlament sein. Natürlich soll da keiner unvorbereitet reingehen. Aber wenn Haltungen schon vorher feststehen, können wir das Parlament auch ganz abschaffen — dann stören Repräsentanz oder Direktmandate auch nur den perfekten Ablauf. Es gibt einen großen Beamtenapparat, wir brauchen dann auch keine Minister, mit Ministergehältern und Fuhrpark und keine Sitzreihen. Dann können die Parteien einfach nur ihre Position zu Papier geben und wie entschied wird, wird dann nach Proporz entschieden. Sprich CDU ‚SPD , etc. erhalten ein festes Stimmengewicht. Das ganze drumherum ist dann nur Zirkus,der uns alle zigmillionen Euro kostet.
Nein, das ganze parlamentarische System macht nur dann Sinn, wenn Entscheidungen so lange offen sind, bis das Parlament als höchstes Gremium entscheidet. Hier soll der Wählerwille zum Ausdruck kommen. Und die Parlamentarier sollen für ihre Wähler so entscheiden, wie die Wähler es wollen. Wobei da ja schon das Problem ist, dass Abgeordnete ja auch nur ihrem Gewissen verpflichtet sind und es kein imperatives Mandat gibt. Das heisst es gibt zwar ein repräsentatives Parlament, aber keine Repräsentation der WählerInnen. Die Parlamentarier sind total frei in dem wie sie abstimmen. Und so wie Du es zutreffend beschreibst, bestimmen am anderen Ende ausschließlich Ministerien und Parteien die Politik. Ich sage bewußt BESTIMMEN und nicht MITWIRKEN. Es ist ja eher umgekehrt: Der Bürger wirkt an der Willensbildung von Staat und Parteien mit, spielt aber in dem ganzen eine untergeordnete Rolle.
Das ist ja auch der Punkt wo Leute auf die Straße gehen, wo sich Wutbürger formieren, „Echte Demokratie” fordern, „Empört” sind. Weil das, was sich da abspielt nur eine Farce ist. Man tut so, als gäbe es Demokratie. Dabei hört die Mitbestimmung schon vor der Wahlurne auf. Denn was ich wähle hat gar keinen Einfluss darauf, welche Politik gemacht wird. Es gibt keine Koppelung meiner Stimme oder die Stimmen der Mehrheit an eine Umsetzung dessen oder der Parteiprogramme. Und das Ergebnis ist die vielbeklagte Politikverdrossenheit. Bürger die sagen: Wir können ja eh nix ändern sind gar nicht so dumm, sondern nur desillusioniert und es mangelt Ihnen an der Phantasie zu Alternativen, jenseits einer rein parlamentarischen Demokratie.
Es gibt in der Tat eine Parallele zur Diskussion über Pairing. Wer vom Parlament nur erwartet, dass es abnickt, was vorher in kleinen Zirkeln entschieden wurde, der ist ebenso selbstverständlich für Pairing wie für das zu-Protokoll-geben von Reden und kann die Empörung der Öffentlichkeit über die Abstimmung zum Meldegesetz nicht nachvollziehen.
Der Vergleich zum kommunikativen System vor Gericht ist interessant, ich weiß aber nicht, wo er hinführen soll. Bei Gericht ist einiges formalisiert, aber es ist völlig üblich, dass die Beteiligten tatsächlich miteinander reden, dass man auf die Argumente des anderen reagiert und dass die Redebeiträge die Chance haben, das Ergebnis des Verfahrens zu beeinflussen. Wenn abschließend die getroffene Entscheidung mündlich begründet wird, gibt es auch keine Gegenrede mehr, die folgt ggf. in der nächsten Instanz.